Suche
ARCHIV
Ausführungsvorschrift zur einheitlichen Anwendung der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (AVGebühren)
Ausführungsvorschrift zur einheitlichen Anwendung der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (AVGebühren)
vom 8. April 2014
Ministerium des Innern
Aktenzeichen 13-532-23
Inhaltsübersicht
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Umsatzsteuer
§ 3 Gebühren- und Auslagenbefreiung
§ 4 Gebührenpflicht für juristische Personen
§ 5 Wertgebühr
§ 6 Zeitgebühr
§ 7 Auslagen
§ 8 Gebühren in besonderen Fällen
§ 9 Gebührenanspruch
§ 10 Gleichstellungsbestimmung
§ 11 Übergangsregelung
§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Anlagen: gesetzliche Sonderregelungen
verwaltungsrechtliche Hinweise
Allgemeines
Aufgrund § 3 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 7 Absatz 1, Nummer 1, § 9 Satz 2 und § 18 Absatz 2, Satz 2 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 246) verordnet der Minister des Innern:
Zitierhinweise
Die Vermessungsgebührenordnung muss auf Kostenbescheiden sowie in Gebührenvorgängen zitiert werden. Die Zitierung mit der Normal-Form ist dabei ausreichend. In besonderen Fällen ist die Lang-Form zu verwenden. Nach jeder Novellierung ist der Halbsatz “ …, (zuletzt - erst ab der zweiten Änderung) geändert durch die Verordnung vom TT.MM.JJJJ (GVBl. II Nr. XX/JJJJ)“ in der jeweils aktuellen Form zu ergänzen.
Normal-Form: Vermessungsgebührenordnung vom 16.09.2011 (GVBl. II Nr. 55), geändert durch die Verordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59).
Lang-Form: Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Vermessungsgebührenordnung - VermGebO) vom 16.09.2011 (GVBl. II Nr. 55), geändert durch die Verordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59).
Die Vermessungsgebührenordnung vom 16.09.2011 ist durch Artikel 1 der ersten Verordnung zur Änderung der Vermessungsgebührenordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59 vom 24.07.2013) geändert worden und durch Artikel 2 am Tage nach der Veröffentlichung (25.07.2013) In Kraft getreten.
§ 1
Anwendungsbereich
Für die in der Anlage (Gebührentarif) aufgeführten öffentlichen Leistungen der Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens sind Gebühren nach den dort genannten Gebührensätzen zu erheben.
Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich der Verordnung erstreckt sich auf öffentliche Leistungen - also die hoheitlichen, öffentlich-rechtlichen Tätigkeiten (Amtshandlungen) - der benannten Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens (§ 26 BbgVermG). Die Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens sind Behörden im Sinne des § 2 Abs. 4 GebGBbg. Für jede Amtshandlung ist ein Antrag erforderlich.
Die Gebühren und Auslagen werden dem Schuldner mit einem Kostenbescheid bekannt gegeben. In dem Kostenbescheid ist das aktuelle Gebührenrecht zu zitieren.
Gebühren nach dieser Verordnung für hoheitliche Vermessungsleistungen und Entgelte nach Regeln für fiskalische Tätigkeiten müssen grundsätzlich getrennt durch Bescheid bzw. durch Rechnung festgesetzt und beigetrieben werden. Mit einem hoheitlichen Gebührenbescheid können grundsätzlich keine privatrechtlichen Entgelte erhoben werden. Ein Sonderfall liegt vor, wenn es sich um Auslagen für Tätigkeiten Dritter, welche für die hoheitliche Entscheidung erforderlich waren, handelt; § 9 Gebührengesetz für das Land Brandenburg - GebGBbg).
Ein Gebührenanspruch besteht nicht, wenn die erbrachten Leistungen weder dem Antrag noch der Pflichterfüllung des Eigentümers entsprechen.
Öffentliche Leistung
Eine öffentliche Leistung ist die besondere öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit (Amtshandlung) einer Behörde, für die Gebühren zu erheben sind. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass individuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner durch diese Gebührenordnung auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leistung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken.
Gebührentarif
Der Gebührentarif beschreibt als Leistungskatalog die Gegenstände (Amtshandlungen), für die eine Gebühr erhoben wird. Die ausgewiesene Gebühr für den einzelnen Gegenstand berücksichtigt die Regelleistungen, die mit der öffentlichen Leistung verbunden sind.
Antrag
Der Antrag ist eine Willenserklärung einer natürlichen oder juristischen Person zur Ausführung einer bestimmten öffentlichen Leistung einer Behörde zum eigenen Nutzen, für die eine Gebühr nach den Tarifen dieser Verordnung zu erheben ist. Jede beantragte Amtshandlung ist gebührentechnisch einzeln abzurechnen. In der Umgangssprache wird anstatt des Antrags oftmals auch der Ausdruck "Auftrag" verwendet. Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein, d.h. es muss zweifelsfrei sein, welche Amtshandlung wo ausgeführt werden soll (Bezeichnung des Flurstücks, die Art der öffentlichen Leistung, die Abrechnungsparameter, Bezeichnung des Ausführungsortes ggf. mithilfe einer Skizze). Werden gleichzeitig mehrere Amtshandlungen beantragt, sind diese auch mehrere Anträge, für die jeweils eine Gebühr zu erheben ist. Die Regelungen der Tarifstellen 4.3 und 7 bleiben hiervon unberührt. Gebühren für mehrere Amtshandlungen können in einem Kostenbescheid gemeinsam festgesetzt werden.
§ 2
Umsatzsteuer
Soweit die öffentlichen Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, werden die Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben.
Umsatzsteuer
In den Gebührensätzen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten. Sie muss zusätzlich für umsatzsteuerpflichtige Amtshandlungen erhoben werden. Der Umsatzsteuer unterliegen nach Sinn und Zweck des Umsatzsteuergesetzes solche Tätigkeiten der Katasterbehörden, die nach ihrer Art auch von den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren ausgeübt werden dürfen (Umsatzsteuer-Hinweise, UstHw). Hierzu gehört aufgrund der Regelung des § 26 BbgVermG auch die Erteilung der Vermessungsunterlagen, aber nicht die Übernahme von Vermessungsschriften.
Bei den Gebühren, die nach dem Zeitaufwand zu erheben sind, ist die Umsatzsteuer nur bei den Amtshandlungen zu erheben, die den o. g. Kriterien entsprechen.
§ 3
Gebühren- und Auslagenbefreiung
Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die
- im Zuge der Zusammenarbeit des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg und der Katasterbehörden sowie der Katasterbehörden untereinander anfallen oder
- der Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster dienen.
Zusammenarbeit LGB und KB
Die kostenfreien öffentlichen Leistungen ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit zwischen der LGB und den Katasterbehörden sowie der Katasterbehörden untereinander bei der Erfüllung ihrer gesetzlich definierten Aufgaben (§ 26 BbgVermG). Für dieses gegenseitige Zuarbeiten werden keine Gebühren und Auslagen erhoben.
Übereinstimmung mit dem Grundbuch
Die Grundlage für die Eintragung und Benennung der Grundstücke im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs ist gemäß § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung das amtliche Verzeichnis (Liegenschaftskataster). Das Liegenschaftskataster führt nachrichtlich die Eigentumsangaben des Grundbuchs. Die Verknüpfung der Benennung der Grundstücke im Liegenschaftskataster und den Eintragungen der Eigentümer in Abteilung I des Grundbuchs gewährleistet die Eigentumssicherung am Grund und Boden. Deshalb müssen die Angaben in Grundbuch und Kataster stets in Übereinstimmung gehalten werden. Das Verfahren für die Erhaltung der Übereinstimmung zwischen dem Grundbuch und dem Liegenschaftskataster ist in der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung des Ministers des Innern und der Ministerin der Justiz vom 2. März 2009 (ABl. S. 537) (3850 E-II.4/01) geändert durch die Gemeinsame Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz und des Ministers des Innern zur Änderung der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung vom 2. März 2009 vom 30. Oktober 2013 (3850-II.015), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 51 vom 11. Dezember 2013 festgelegt.
Ein weiteres gemeinsames Anliegen von Grundbuch und Kataster ist die systematische Verminderung der Buchungseinheiten zur Förderung der Übersichtlichkeit. Für die Beurkundungen und Beglaubigungen zur Vereinigung oder Teilung von Grundstücken werden deshalb Gebühren nicht erhoben (§ 20 Abs. 3 BbgVermG). Analog erhebt auch die freiwillige Gerichtsbarkeit gemäß Kostenverzeichnis (Anlage 1), Hauptabschnitt 4, Gebühren-Nr. 14160 Abs. 3 des Gesetzes über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- und Notarkostengesetz - GNotKG), keine Gebühren für die Eintragung der Vereinigung mehrerer Grundstücke zu einem Grundstück und für die Zuschreibung eines oder mehrerer Grundstücke zu einem anderen Grundstück als dessen Bestandteil, einschließlich hierzu notwendiger Grundstücksteilungen und der Aufnahme des erforderlichen Antrags durch das Grundbuchamt, wenn die das amtliche Verzeichnis (§ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung) führende Behörde (Katasterbehörde) bescheinigt, dass die Grundstücke örtlich und wirtschaftlich ein einheitliches Grundstück darstellen oder die Grundstücke zu einem Hof gehören. Die Bescheinigung ist direkt von der Katasterbehörde zusammen mit dem Vereinigungsantrag an das Grundbuchamt zu senden. Vereinigungsanträge von ÖbVI können kostenfrei über die Katasterbehörde beim Grundbuchamt eingereicht werden. Auf die Verfahrensvorschriften zur Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung oder Teilung von Grundstücken wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.
§ 4
Gebührenpflicht für juristische Personen
Für öffentliche Leistungen der Aufgabenträger des amtlichen Vermessungswesens bleiben die in § 8 Abs. 1 Gebührengesetz für das Land Brandenburg genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts und Stiftungen des bürgerlichen Rechts zur Zahlung von Gebühren verpflichtet.
Gebührenpflicht
Der § 8 GebGBbg regelt die persönliche Gebührenbefreiung. Nach § 8 Abs. 1 werden die juristischen Personen des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts von der Zahlung von Gebühren befreit. § 3 Abs. 2 GebGBbg ermächtigt den Verordnungsgeber, die persönliche Gebührenfreiheit einzuschränken bzw. ganz aufzuheben. Von dieser Ermächtigung wurde hier Gebrauch gemacht. Danach sind alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts und die Stiftungen des bürgerlichen Rechts bei öffentlichen Leistungen des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) sowie der Katasterbehörden zur Zahlung der Gebühren nach dieser Verordnung verpflichtet. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure sind beliehene Unternehmer. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 8 GebGBbg gilt die persönliche Gebührenbefreiung nach § 8 Abs. 1 GebGBbg nicht für Leistungen von Beliehenen. Sonderregelungen und Gebühren für Widerspruchsbescheide, die gemäß § 18 GebGBbg erhoben werden, bleiben hiervon unberührt.
Juristische Personen des öffentlichen Rechts
Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind Rechtssubjekte, die auf öffentlich-rechtlichem und auf privatrechtlichem Gebiet Rechtsfähigkeit besitzen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung und unterstehen staatlicher Aufsicht. Sie werden eingeteilt in Körperschaften (z. B. Universitäten) bzw. Gebietskörperschaften (z. B. Gemeinden, Landkreise), Anstalten (z. B. öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten) und Stiftungen (z. B. Stiftung Preußischer Kulturbesitz) des öffentlichen Rechts.
Stiftungen des bürgerlichen Rechts
Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts sind Rechtsubjekte, die auf privatrechtlichem Gebiet Rechtsfähigkeit besitzen. Sie sind nach § 8 Abs. 1 Nr. 8 GebGBbg persönlich von Gebühren befreit, wenn sie ihren Sitz im Land Brandenburg haben. Ihre Benennung in § 4 VermGebO stellt klar, dass auch diese Stiftungen von der Einschränkung der persönlichen Befreiungen nach § 3 Abs. 2 GebGBbg erfasst sind.
§ 5
Wertgebühr
(1) Ist eine Gebühr nach dem Wert des Bodens zu berechnen, so ist der Bodenrichtwert zu Grunde zu legen. Ist kein geeigneter Bodenrichtwert vorhanden, ist die Gebühr nach dem Verkehrswert zu berechnen.
(2) Ist eine Gebühr nach dem Wert einer baulichen Anlage zu berechnen, so ist der Wert der fertigen baulichen Anlage zu Grunde zu legen.
(3) Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert nachzuweisen. Wird der Nachweis nicht oder unzureichend erbracht, so schätzt die gebührenerhebende Behörde den Wert. Gegebenenfalls ist auf Kosten des Gebührenschuldners ein Sachverständiger hinzuzuziehen.
Wert des Bodens
Dem Begriff “Wert“ wohnt die Bemessung oder Einschätzung einer Sache inne. Für den Grund und Boden eines unbebauten Grundstücks wird er als Bodenwert bezeichnet. Der Ermittlung des Bodenwertes ist der Bodenrichtwert zu Grunde zu legen. Der Wert des Bodens ist auf der Grundlage des aktuellen Bodenrichtwertes zu ermitteln. Ist kein geeigneter Bodenrichtwert vorhanden, ist die Gebühr nach dem Verkehrswert zu berechnen.
Bodenrichtwert
Der Bodenrichtwert (§ 196 Abs. 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV), insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit (§ 6 Abs. 1 ImmoWertV) weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse (§ 3 Abs. 2 ImmoWertV) vorliegen. Die Bodenrichtwerte werden online im Brandenburg-Viewer auf der Seite der LGB (http://www.geobasis-bb.de/bb-viewer.htm) kostenfrei zur Ansicht zur Verfügung gestellt.
Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des Bodenrichtwertgrundstücks hinreichend mit denen des Antragsflurstücks übereinstimmen. Dieses ist z. B. nicht der Fall, wenn sich der Bodenrichtwert auf Bauland bezieht und Gartenland zu vermessen ist oder wenn das Flurstück durch Planfeststellungsverfahren (Infrastrukturanlagen, Bergbau, usw.) in Anspruch genommen wird und dadurch eine andere Qualität erhält, die nicht mehr dem Bodenrichtwertgrundstück entspricht (z. B. Bauland wird für den Ausbau einer Straße in Anspruch genommen: hier ist bei der Vermessung der Straße der Wert für Straßenlandan zusetzen).
Verkehrswert
Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (§ 194 BauGB).
Der Verkehrswert ist für die Gebührenberechnung zum Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung zu bemessen (§ 10 GebGBbg). In Abhängigkeit von dem jeweiligen Entwicklungszustand des Baugebietes (Rohbauland, baureifes Land, erschließungsbeitragspflichtig oder -frei) kann es auftreten, dass bezüglich der Gebührenberechnung für ein größeres Baugebiet von der ersten örtlichen Vermessung bis hin zur Übernahme der Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster unterschiedliche Verkehrswerte zugrunde gelegt werden müssen. Während der Verkehrswert der für die Bebauung vorgesehenen Flächen im Regelfall steigen dürfte, wird er bei den als Straßenland vorgesehenen Flächen fallen, da diese Gemeinbedarfsflächen in letzter Konsequenz weitestgehend dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entzogen werden.
Wert der baulichen Anlage
Der Zeitpunkt der Wertfeststellung für die Gebührenfestsetzung ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung (§ 10 GebGBbg). Im Falle der Einmessung einer baulichen Anlage, die nach § 23 Abs. 2 Satz 2 BbgVermG regelmäßig vor der endgültigen Fertigstellung der baulichen Anlage vorgenommen wird, ist zu beachten, dass die VermGebO auf den Wert der fertigen baulichen Anlage abstellt, zum Beispiel auf ein bezugsfertiges Wohngebäude. Dies gilt auch, wenn die bauliche Anlage zum Zeitpunkt der Beendigung der Amtshandlung noch nicht fertig gestellt ist.
Der Wert der baulichen Anlage ist der Verkehrswert des Grundstücks abzüglich des Bodenwertes.
Der Wert der baulichen Anlage entspricht daher nur bei Neubauten in der Regel den Normalherstellungskosten des Gebäudes. Bei Einmessungen baulicher Anlagen, die mehrere Jahre nach der Fertigstellung erfolgen, ist entsprechend dem Grundsatz des § 10 GebGBbg der Wert zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung anzuhalten, also der Zeitwert der baulichen Anlage. Dabei sind einerseits alle nachträglich vorgenommen Änderungen an der baulichen Anlage und andererseits die Alterswertminderung (Abschreibung) zu berücksichtigen. Die wirtschaftliche Abschreibung von industriellen baulichen Anlagen bleibt außer Betracht. Der Zeitwert von industriellen baulichen Anlagen ist von der Vermessungsstelle nach sachverständigen Gesichtspunkten zu schätzen.
Bei Funktionsgebäuden gehören auch die technischen baulichen Bestandteile zum Wert der baulichen Anlage, wenn sie fest mit dieser verbunden sind. Zum Beispiel ist bei einem Bahnhof nicht nur die äußere bauliche Hülle wertmäßig zu berücksichtigen, sondern auch die Wertanteile der Ladenstraße (ohne mobile Einrichtungen und Verkaufsauslagen), Rolltreppen, Anzeigetafeln, Gleisanlagen etc. Sinngemäß ist bei anderen technischen Anlagen vorzugehen und bauliche Bestandteile wertmäßig anzusetzen. Für die Zweckbestimmung unerlässliche Bauteile sind z. B.:
- bei einem Windkraftrad - der Generator
- bei einem Trafohäuschen - der Transformator
- bei einer Brücke - alle Bestandteile einer Brücke
- bei einer Fabrikhalle - fest verbaute Lüftungs- und Klimaanlagen, jedoch keine Produktionsmaschinen
Bei nicht mehr gebrauchsfähigen baulichen Anlagen (die Schlossruine, den stillgelegten Industriebau, das leerstehende Wohngebäude) ist ebenfalls auf den Zeitwert unter der Annahme einer weiteren Nutzung abzustellen.
Der Wert einer bestehenden baulichen Anlage ist sachverständig zu schätzen, ohne eine Umsatzsteuer zu berücksichtigen.
Wird der Wert über die Methoden der Wertermittlung ermittelt, findet die Umsatzsteuer keine zusätzliche Beachtung. Bei der Ermittlung des Wertes von neu errichteten baulichen Anlagen über die Normalherstellungskosten sind diese Normalherstellungskosten einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen.
Wertnachweis
Ist kein geeigneter Bodenrichtwert vorhanden, hat der Gebührenschuldner auf Verlangen den Bodenwert bzw. Wert der baulichen Anlage nachzuweisen. Im Allgemeinen gilt der Nachweis bei Vorlage eines Kaufvertrages oder einer Gebäudeversicherung als erbracht.
Unzureichender Nachweis
Die Entscheidung über die Eignung des Nachweises liegt im Ermessen der Behörde. Die Behörde ist bei einem unzureichenden Nachweis verpflichtet, den Wert ggf. mithilfe eines Sachverständigen zu schätzen.
Schätzung
Es liegt im Wesen einer Schätzung, dass sie nicht oder nur rein zufällig zu einem exakt der Wirklichkeit entsprechenden Ergebnis führen kann. Der Behörde, die sich des Hilfsmittels der Schätzung bedient, muss ein Schätzungsspielraum zugebilligt werden, innerhalb dessen sie die Schätzung noch nicht fehlerhaft vornimmt. Fehlerhaft und damit rechtswidrig ist nur die Überschreitung der äußeren Grenzen dieses Schätzungsspielraumes.
Als Grundlage für die Schätzung von Bodenwerten eignen sich in besonderem Maße die von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte ermittelten Bodenrichtwerte. Da die Bodenrichtwerte nach festgelegten Grundsätzen ermittelt werden, ist die Richtigkeit eines ausgewiesenen Bodenrichtwertes zumindest für Grundstücke mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen gewährleistet. Weichen die maßgeblichen wertbestimmenden Merkmale des zu schätzenden Grundstücks von dem Richtwertgrundstück erheblich ab, so ist dies bei der Schätzung des Bodenwertes zu berücksichtigen.
Liegen keine Bodenrichtwerte für das betreffende Grundstück vor, so sind die Bodenrichtwerte vergleichbarer Grundstücke für die Schätzung heranzuziehen (Urteil, VG Minden, 9 K 1725/84; Urteil, VG Aachen, 2 K 1777/84).
Sachverständiger
Die Tätigkeit als Sachverständiger stellt keinen eigenen Beruf, sondern einen Berufszweig in einem ganz speziellen Fachgebiet dar. Es gibt weder eine gesetzliche Normierung noch spezifische Ausbildungsmöglichkeiten. Die abgeschlossene Ausbildung als Techniker oder Ingenieur, eine langjährige berufspraktische Erfahrung, der fortgesetzte Bezug zur Praxis, die ständige Auseinandersetzung mit der technischen Weiterentwicklung im jeweiligen Berufsfeld, dem jeweils neuesten Stand der Technik und den dazugehörenden Regelungen (Normen) werden allgemein als Grundvoraussetzung für eine Sachverständigentätigkeit angesehen. Eine spezielle Zulassung ist hierzu nicht erforderlich. Der Begriff "Sachverständiger" ist also im Gegensatz zu den Begriffen "Ingenieur", “Architekt”, “Rechtsanwalt" und vielen anderen Berufsbezeichnungen nicht gesetzlich geschützt.
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige hat nach den Sachverständigenverordnungen der Kammern eine Reihe von besonderen Pflichten. Er muss grundsätzlich jedermann als Sachverständiger zur Verfügung stehen, er muss neutral sein und ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken werden von der Industrie- und Handwerkskammer (IHK) bestellt. Die Bezeichnung ist geschützt.
§ 6
Zeitgebühr
(1) Sind Gebühren nach dem Zeitaufwand zu berechnen, sind der Gebührenrechnung jeder außen- oder innendienstlich begonnenen halben Stunde zu Grunde zu legen
- für den Leiter der Katasterbehörde 45 Euro,
- für den Präsidenten des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 45 Euro,
- für den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 45 Euro,
- für eine vermessungstechnische Fachkraft 40 Euro oder
- für eine Hilfskraft 25 Euro.
(2) Der Zeitaufwand bestimmt sich nach der Arbeitszeit, die von einer entsprechend ausgebildeten Dienstkraft benötigt wird, einschließlich der unvermeidbaren Reisezeiten.
Gebühren nach dem Zeitaufwand
Die Höhe der Stundensätze berücksichtigt die erforderliche kostenintensive technische Ausrüstung der Behörden zur vorschriftenkonformen Aufgabenwahrnehmung z. B. bei der Nutzung der Satellitentechnologie und moderner IT-Systeme für die durchgängige elektronische Abwicklung der Vermessungsgeschäfte unter Nutzung von Online-Diensten. Diese Hochtechnologie ermöglicht es, zweckmäßig, wirtschaftlich und kostenbewusst zu arbeiten. Sie führt nachweislich zu deutlich reduzierten Arbeitszeiten und damit im Endergebnis für den Kunden trotz der Höhe der Stundensätze zu angemessenen Kosten.
Für Amtshandlungen, für die der Gebührentarif die “Zeitgebühr“ vorsieht, sind die Regelungen des § 6 VermGebO anzuwenden. Hier besteht keine Obergrenze.
Die Entgelte nach dem Zeitaufwand im VermEVz enthalten die Umsatzsteuer. Die vergleichbare Zeitgebühr in der VermGebO enthält keine Umsatzsteuer. Gemäß § 2 VermGebO ist hier die Umsatzsteuer nur bei den steuerpflichtigen Amtshandlungen zu erheben.
Leiter der Katasterbehörde, der Präsident der LGB bzw. der ÖbVI
Diese Personen verfügen zum einen über eine besondere Qualifikation und nehmen zum anderen Aufgaben wahr, die entsprechend ihrer Funktion erhebliche Eigenverantwortlichkeit und Führungs- bzw. unternehmerische Verantwortung erfordern. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben gelten die Stundensätze daher auch für die Vertretung.
Vermessungstechnische Fachkraft
Die vermessungstechnische Fachkraft ist eine Person, die eine vermessungstechnische Ausbildung abgeschlossen hat und in diesem Fachbereich über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Sie trägt die Verantwortung für ihr Handeln in Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben. Wird eine Leitungskraft nach Nr. 1 bis Nr. 3 als vermessungstechnische Fachkraft eingesetzt, ist sie auch kostenrechtlich als vermessungstechnische Fachkraft nach Nr. 4 zu behandeln.
Hilfskraft
Ein Messgehilfe ist eine für vermessungstechnische Hilfsarbeiten eingesetzte Person. Eine abgeschlossene vermessungstechnische Berufsausbildung liegt nicht vor. Wird eine Leitungskraft nach Nr. 1 bis Nr. 3 oder eine vermessungstechnische Fachkraft nach Nr. 4 als Messgehilfe eingesetzt, ist sie auch kostenrechtlich als Hilfskraft nach Nr. 5 zu behandeln.
§ 7
Auslagen
(1) An Auslagen sind vom Gebührenschuldner zu erstatten
- in Verbindung mit öffentlichen Leistungen verauslagte Gebühren,
- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und öffentliche Zustellungen,
- Mehrkosten, die durch Sonderwünsche des Antragstellers entstehen.
(2) Alle weiteren Auslagen, die mit der öffentlichen Leistung notwendig werden, sind mit der Gebühr abgegolten.
(3) Wenn für eine öffentliche Leistung Gebührenfreiheit besteht oder von der Gebührenerhebung ganz oder teilweise abgesehen wird, sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, neben den in Absatz 1 auch die in § 9 Gebührengesetz für das Land Brandenburg aufgeführten Auslagen zu erstatten.
Verauslagte Gebühren
Alle Gebühren, die für die Erfüllung des Antrages notwendigerweise anfallen, sind vom Kostenschuldner zu erstatten. Hierzu gehören auch die Gebühren, die eine Behörde für den Kostenschuldner verauslagt, also vorgestreckt hat. Insbesondere sind das die Gebühren der Katasterbehörden für die Vorbereitung von Vermessungsunterlagen (vgl. zur Umsatzsteuerpflicht § 2 - Umsatzsteuer). Auslagen, die in § 9 GebGBbg genannt werden, sind in den Tarifen enthalten und fallen nicht unter die Nr. 1 dieses Absatzes.
Öffentliche Bekanntmachung
Das Verfahren wird angewandt im Zuge der Offenlegung im Zusammenhang mit der Neueinrichtung und umfangreichen Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie der Offenlegung der Grenzniederschrift.
Öffentliche Zustellung
Die öffentliche Zustellung nach dem Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) ist ein Sonderfall und die ultima ratio des Zustellungsverfahrens. An sie werden im Hinblick auf den Nachweis der allgemeinen Unbekanntheit sehr hohe Anforderungen gestellt (siehe auch Erläuterungen zu Nr. 12.3 der Liegenschaftsvermessungsvorschrift - VVLiegVerm).
Sonderwünsche des Antragstellers
Sonderwünsche liegen vor, wenn die beantragte Leistung der den Gebührentarifen zugrunde liegenden Standards abweicht. Dieses können Auszüge in einem speziellen Datenformat oder Informationen auf einem besonderen Datenträger ebenso sein, wie der Wunsch, das Antragsziel durch Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit schneller zu erreichen.
Mit der Gebühr abgegolten
Um den Verwaltungsaufwand zur Berechnung von Auslagen weitgehend zu vermeiden, hat der Verordnungsgeber die bei der Bearbeitung eines Antrags regelmäßig auftretenden Auslagen in die Gebühr einbezogen. In § 7 VermGebO sind deshalb nur die Auslagen aufgeführt, die nicht mit der Gebühr für eine Amtshandlung abgegolten und somit vom Gebührenschuldner gesondert zu erstatten sind.
§ 8
Gebühren in besonderen Fällen
(1) Kann die Bearbeitung eines Antrags wegen Uneinigkeit der Beteiligten oder aus anderen Gründen, welche die Behörde nicht zu vertreten hat, nicht beendet werden, ist § 17 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg entsprechend anzuwenden.
(2) Wird eine vorzeitig beendete öffentliche Leistung auf erneuten Antrag hin oder nach Wegfall des Hindernisses fortgesetzt, so sind bereits entstandene Gebühren insoweit anzurechnen, als durch die frühere Teilleistung Arbeitsaufwand eingespart wird.
(3) Gebühren für öffentliche Leistungen, für die im Gebührentarif eine besondere Gebühr nicht vorgesehen ist, werden nach der benötigten Zeit in Verbindung mit den Gebührensätzen des § 6 erhoben. Diese Gebühr darf die Höhe von 1.000 Euro nicht überschreiten.
Uneinigkeit der Beteiligten
Die Uneinigkeit der Beteiligten im Grenzfeststellungsverfahren kann dazu führen, dass die beantragte Liegenschaftsvermessung nicht zum Abschluss gebracht werden kann. § 17 des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg ist in diesen Fällen entsprechend anzuwenden.
Anrechnung von Gebühren
Der Verordnungsgeber berücksichtigt mit der Gebührenregelung bereits geleistete und bezahlte Arbeiten.
Auffangtarif
Der Absatz 3 ermöglicht die Kostenberechnung für Leistungen, die der Gebührentarif nicht spezifiziert ausweist. Die Regelung dient daher vorrangig als Auffangtarif für nicht vom Gebührentarif erfasste Leistungen und kann alleine oder in Kombination mit pauschalierten Gebührensätzen zur Anwendung kommen. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach dem Zeitaufwand (§ 6 VermGebO). Die Gebühr für eine Amtshandlung darf 1.000 Euro nicht überschreiten.
Die Gebührenermäßigung aus Billigkeitsgründen (§ 20 GebGBbg) bleibt hiervon unbenommen.
§ 9
Gebührenanspruch
Werden Geobasisinformationen aus dem Liegenschaftskataster nicht von einer Katasterbehörde bereitgestellt, stehen der Katasterbehörde, die die Daten führt, und der bereitstellenden Behörde die Gebühren, die nach dem Gebührentarif festzusetzen sind, zu gleichen Anteilen zu.
Gebührenanspruch
Daten und Informationen können nach § 26 BbgVermG auch von Behörden erteilt werden, die nicht originär für die Führung dieser Daten zuständig sind. Da die Gebühren von der Behörde vereinnahmt werden, die eine kostenpflichtige Amtshandlung vornimmt (§ 11 GebGBbg), hat der Verordnungsgeber die Aufteilung der Gebühreneinnahmen in Verbindung mit § 13 GebGBbg geregelt und so Datenführung wie Datenabgabe gleichermaßen gewürdigt.
Alle an der öffentlichen Leistung beteiligten Behörden erhalten den gleichen Gebührenanteil. Die Behörde, die die Gebühren festsetzt, den Kostenbescheid erstellt und die Gebühren vereinnahmt, trägt die Verantwortung für die richtige Anwendung der Gebührenordnung. Wenn mehr als zwei Behörden an der öffentlichen Leistung beteiligt sind, werden die vereinnahmten Gebühren zu gleichen Teilen auf die beteiligten Behörden aufgeteilt. Zur Verdeutlichung dient folgendes Beispiel: Von der LGB werden kreisübergreifende Geobasisinformationen für fünf Landkreise bereitgestellt. Insgesamt sind somit sechs Behörden (LGB und fünf Landkreise) beteiligt. Jede Behörde erhält ein Sechstel der vereinnahmten Gesamtgebühr.
§ 10
Gleichstellungsbestimmung
Die in dieser Verordnung und im Gebührentarif verwendeten Funktions-, Status- und anderen Bezeichnungen gelten für Frauen und Männer.
§ 11
(aufgehoben)
Die Übergansregelung wurde mit der Änderungsverordnung vom 19.07.2013 aufgehoben. Sie regelte den Gebührenübergang von der VermGebKO vom 22.07.1999 (GVBl. II S. 441) in der Fassung der letzten Änderung vom 12.01.2004 (GVBl. II S. 107) auf die VermGebO vom 16.09.2011 (GVBL II. Nr. 55). Danach waren die Reglungen nur für Amtshandlungen, die vor dem 01.10.2011 beantragt und bis zum Inkrafttreten der Änderungsverordnung abgeschlossen waren, anwendbar. Knapp zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Ursprungsverordnung 2011 müssen nun auch die noch offenen Anträge, die vor dem 01.10.2011 beantragt und noch nicht abgeschlossen sind, eine Gebührenerhöhung in Kauf nehmen. Dies ist auch aus wirtschaftlichen Gründen gegenüber der ausführenden Vermessungsstelle notwendig.
Die Änderungsverordnung selbst hat keine Übergangsregelung, die den Übergang von der Ursprungsverordnung 2011 zu den geänderten Tarifen der Änderungsverordnung 2013 regelt. Der Wegfall des § 11 hat für den Übergang zur Änderungsverordnung keine Bedeutung, weil er nicht auf die Änderungen der Änderungsverordnung 2013 anwendbar gewesen wäre.
Die Gebühren- und Auslagenschuld entsteht mit der Beendigung der Amtshandlung (§ 10 GebGBbg). Das Gebührengesetz sieht keinen besonderen Übergang bei Änderungen der Gebührentarife vor und ermächtigt auch den Verordnungsgeber nicht, einen Übergang selbst zu regeln. Alle Amtshandlungen, die nach dem 24.07.2013 beendet wurden, sind nach den Tarifen der VermGebO in der Fassung der Änderungsverordnung 2013 abzurechnen.
Auch für Amtshandlungen, die bis zur Veröffentlichung des Gebührengesetzes für das Land Brandenburg am 15.07.2009 beantragt und noch nicht beendet waren, gilt das Ende der Amtshandlung als Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld (§ 10 GebGBbg). Die Gebühren für diese Anträge und alle anderen Anträgen sind nach den aktuellen Tarifen festzusetzen.
§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vermessungsgebühren- und Kostenordnung vom 22. Juli 1999 (GVBl. II S. 441), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 12. Januar 2004 (GVBl. II S. 107) außer Kraft.
Inkrafttreten
Die Verordnung ist im Gesetz- und Verordnungsblatt Teil II für das Land Brandenburg Nr. 55 am 21.09.2011 verkündet worden und trat am 01.10.2011 in Kraft.
Die Vermessungsgebührenordnung vom 16.09.2011 ist durch Artikel 1 der ersten Verordnung zur Änderung der Vermessungsgebührenordnung vom 19.07.2013 (GVBl. II Nr. 59 vom 24.07.2013) geändert worden. Gemäß Artikel 2 ist die Änderungsverordnung am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft getreten. Alle Amtshandlungen, die nach dem 24.07.2013 beendet wurden, sind mit den Tarifen der Änderungsverordnung 2013 abzurechnen.
Vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung abgeschlossene Amtshandlungen (z. B. Ausfertigung von Vermessungsunterlagen) behalten auch nach dem 24.07.2013 für die öffentlichen Leistungen, für die sie ausgefertigt wurden, ihre Gültigkeit.
Potsdam, den 16. September 2011
Der Minister des Innern
Dr. Dietmar Woidke
Anlage
(zu § 1)
Gebührentarif (GT)
Allgemeine Regelung:
- Die Verweise innerhalb des Gebührentarifs auf Tarifstellen beziehen immer die hierarchisch untergliederten Tarifstellen mit ein.
- Der Begriff “Kosten“ umfasst Gebühren und Auslagen.
- Grundstück im Sinne dieser Verordnung ist die in der Örtlichkeit unmittelbar zusammenhängende Fläche in einem Eigentum, die eine wirtschaftliche Einheit bildet.
Grundstück
Mehrere Grundbuchgrundstücke eines eingetragenen Eigentümers können so für den Vermessungsauftrag ein Grundstück bilden. Die kleinste Einheit im Liegenschaftskataster ist das Flurstück (§ 12 BbgVermG). Das Grundstück umfasst immer mindestens ein ganzes Flurstück.
Können die beantragten Vermessungen einem Grundstück zugeordnet werden, so sind die Gebühren in den Tarifstellen 2 und 4 für ein Grundstück zu berechnen.
Inhaltsverzeichnis
Nummer Inhalt
1 Informationen und Bescheinigungen
1.1 Selbstständige Entnahme
1.2 Einsichtnahme, Auskünfte und Bescheinigungen
1.3 Ausfertigungen und Beglaubigungen
2 Bereitstellung von Geobasisinformationen der Liegenschaften
2.1 Ausfertigung aktueller Geobasisinformationen
2.2 Ausfertigung von Vermessungsunterlagen
2.3 Prüfung und Beglaubigung von Geobasisinformationen
2.4 Sonstige Unterlagen aus dem Liegenschaftskataster
4 Erfassen von Geobasisdaten
4.1 Einmessung baulicher Anlagen
4.2 Erfassung von Geobasisdaten an Infrastrukturanlagen
4.3 Erfassung von Geobasisdaten an anderen Flurstücken
4.4 Grenzzeugnis
4.5 Abmarkung
4.6 Sonderungen
4.7 Passpunktbestimmung
4.8 Bodenordnungsverfahren
5 Tatbestände an Grund und Boden
5.1 Amtlicher Lageplan
5.2 Grundflächen- und Höhennachweis
7 Übernahme von Geobasisdaten in das Liegenschaftskataster
7.1 Einmessung baulicher Anlagen
7.2 Entstehung neuer Flurstücke
7.3 Feststellung bestehender Grenzen
7.4 Grenzzeugnis, Passpunkte sowie Objekte aus Bestands- und Lageplänen
7.5 Sonstige Liegenschaftsvermessungen
8 Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
8.1 Zulassung
8.2 Kooperation
Selbstständige Entnahme
Die selbstständige Entnahme von Informationen aus den Verzeichnissen des Liegenschaftskatasters gestattet den Zugang zu allen Informationen. Der Antragsteller entnimmt selbst die Daten, die er für sein Vorhaben benötigt. Er muss entsprechende Kenntnis über den sorgsamen Umgang mit den Unterlagen haben. Daher ist die selbstständige Entnahme nur für bestimmte Personen (ÖbVI, Behörden) und für einen bestimmten Zweck (Wissenschaft) zugelassen. Die Behörde kann die selbstständige Entnahme ablehnen, wenn der Antragsteller den Vorgaben nicht entsprechend handelt.
Für die Inanspruchnahme einer Dienstkraft bei der Entnahme von Daten aus den Systemen des Liegenschaftskatasters, die der Antragsteller nicht selbstständig bedienen kann, ist für jeden über eine Arbeitshalbstunde hinausgehenden Zeitaufwand zusätzlich zu Tst. 1.1 die Zeitgebühr nach Tst. 1.2 anzusetzen.
Bescheinigungen
Die Gebühr ist nach der Zeitgebühr (§ 6 VermGebO) abzurechnen. Die Begrenzung nach § 8 Abs. 3 VermGebO findet keine Anwendung.
Einsichtnahme,Auskunft
Die Einsichtnahme gewährt umfassende Information. Die Auskunft ist rechtlich als Unterfall der Einsichtnahme einzustufen. Der Informationsgehalt der Auskunft ist strikt auf das angegebene Informationsziel gerichtet und Ergebnis der Anfrage, die in einen fachlichen Rat münden kann. Sie ist sorgfältig und nach bestem Wissen zu erteilen.
Tst. 1.2 nutzt die Ermächtigung des § 7 GebGBbg, auch einfache schriftliche und einfache elektronische Auskünfte sowie mündliche Auskünfte von mehr als einer Arbeitshalbstunde mit einer Gebühr zu belegen. Lediglich für mündliche Auskünfte vom Umfang bis zu einer Arbeitshalbstunde werden keine Gebühren erhoben. Damit sind auch flurstücksbezogene schriftliche Eigentümerrecherchen, die nach Auffassung des VG Potsdam (Urteile, 10 K 6147/97 und 10 K 45/98) lediglich die Voraussetzungen für Auskünfte einfacher Art erfüllen, gebührenpflichtig.
Die Eigentümerrückverfolgung ist eine schriftliche Auskunft bzw. Bescheinigung über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (Flurstückshistorie, Voreigentümer). Die Gebühr ist nach dieser Tarifstelle nach dem Zeitaufwand (§ 6 VermGebO) abzurechnen. Die Begrenzung nach § 8 VermGebO findet keine Anwendung.
Die Grenzbescheinigung, die von einer Vermessungsstelle hauptsächlich für Beleihungszwecke ausgestellt wird, ist eine Bescheinigung nach dieser Tarifstelle zum Nachweis darüber, auf welchem Flurstück Gebäude errichtet wurden und ob beim Bau Grenzüberschreitungen vorgekommen sind.
Beispiele
- Sind ausdrücklich nur Auskünfte zu Grenzmaßen beantragt, können diese in einer Skizze, einem Auszug aus der Liegenschaftskarte oder einer sonstigen Unterlage eingetragen werden, die eine eindeutige Zuordnung der Maße zu den Grenzen des Flurstückes ermöglicht. Die Gebühren sind allein nach Zeitaufwand zu berechnen.
- Wird ausdrücklich ein Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Grenzmaßen beantragt, ist das Ermitteln und Eintragen der Grenzmaße nach Zeitaufwand, der Auszug nach Tst. 2.1 abzurechnen. Ist die Eintragung aufgrund des kleinen Maßstabes der analogen Liegenschaftskarte nicht möglich und deshalb die Karte im erforderlichen Maßstab zu vergrößern, so kann dies dem Zeitaufwand zugerechnet werden.
- Beantragt ein Antragsteller ausdrücklich eine Auskunft, durch welche Umstände Änderungen im Liegenschaftskataster vorgenommen wurden und ist hierzu eine Sichtung und Überprüfung der Verzeichnisse auf Veränderung unumgänglich, ist diese Auskunft eine gebührenpflichtige Amtshandlung nach Tst. 1.2 (Beschluss, VG Potsdam, 4 L 1001/01).
Beglaubigungen
Für Beglaubigungen von Urkunden, Abschriften, Ablichtungen oder Plänen und anderen Dokumenten sind die Normen des § 33 Verwaltungsverfahrensgesetzes zu beachten.
Die Gebühren für die Aktualisierung von Auszügen, die nicht mehr aktuell sind, werden nach Tarifstelle 2 festgesetzt.
Ausfertigung
Die Ausfertigung ist die Kopie eines amtlichen Datenbestandes, die einen Ausfertigungsvermerk der Behörde enthält (Nr. 4.11 und 4.12 VVBeGeo). Sie wird von der Behörde vorgenommen, die den Datenbestand führt.
Die Tarifstelle 2.1.8 ist nur anzuwenden, wenn einzelne Auszüge aus dem Zahlenwerk von privaten Antragstellern beantragt werden, die nicht mit einem Vermessungsauftrag im Zusammenhang stehen.
Auszug eines ganzen Kartenblattes (ca. DIN A1)
Großflächige Auszüge größer DIN A3 werden nach Tarifstelle 2.1.2 abgerechnet.
Auszug aus der Liegenschaftskarte
Der Auszug aus der Liegenschaftskarte ist die im DIN-Format ausgedruckte Einzelseite.
Auszug aus den Flurstücks- Grundstücks- Eigentümer- oder Bestandsnachweisen
Ein Auszug umfasst alle Seiten, die unter dem beantragten Kennzeichen ausgegeben werden.
Auszug aus dem Zahlennachweis
Der Auszug aus dem Zahlennachweis ist die im DIN-Format ausgedruckte Einzelseite. Wird die Vor- und Rückseite bedruckt, so sind zwei Auszüge abzurechnen. Die Auszüge aus dem Zahlenwerk sind an Privatpersonen für nicht gewerbliche Zwecke in Form von Einzelauszügen zu erteilen. Unterlagen für Vermessungsstellen sind nach Tarifstelle 2.2 oder 2.3 abzurechnen.
Grundsätzlich sind Auszüge in Originalgröße auszudrucken.
Einzelne Auszüge aus dem Zahlenwerk für den privaten Gebrauch eines Eigentümers werden nach Tarifstelle 2.1.8 abgerechnet.
Bereitstellung von Vermessungsunterlagen für Vermessungsleistungen
Vermessungsunterlagen werden grundsätzlich für alle Vermessungstätigkeiten nach Tarifstelle 2.2 (hoheitlich) oder Tarifstelle 2.3 (fiskalisch) abgerechnet.
Vermessungsunterlagen
Vermessungsunterlagen sind alle Daten des amtlichen Vermessungswesens, die für die Erledigung des Antrags für eine Einmessung einer baulichen Anlage (Tst. 4.1), für eine Infrastrukturanlage (Tst. 4.2), auf einem Grundstück (Tst. 4.3, 4,4, 4.5 oder 4.6) für einen Passpunkt (Tst. 4.7) oder für ein Bodenordnungsverfahren (Tst. 4.8) benötigt werden. Dies schließt die automatisiert geführten, digitalen Informationen des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft ebenso ein, wie die analog geführten Nachweise. Sie sind vor Beginn der örtlichen Vermessungstätigkeiten auszufertigen. Die Amtshandlung ist damit beendet und es entsteht die Gebührenschuld nach § 10 GebGBbg. Spätere Ergänzungen oder Nachlieferungen oder die Aktualisierung der ALKIS-Daten sind jederzeit möglich. Hierdurch entsteht keine neue Amtshandlung.
Mit der Tarifstelle 2.2.2 werden die Vermessungsunterlagen für eine Tätigkeit nach Tarifstelle 4.1 (bauliche Anlage) abgerechnet. Grundsätzlich ist für eine bauliche Anlage eine Gebühr nach dieser Tarifstelle und für jede weitere bauliche Anlage (Zweckerweiterung) nach Tarifstelle 2.2.8 (siehe Beispiele zu Tst. 4.1) zu erheben. Eine Ausnahme wird für Wohnnebengebäude formuliert, die gleichzeitig mit einem dazugehörigen Eigenheim eingemessen werden. In diesem Fall sieht die Tarifstelle vor, dass der Wert des Nebengebäudes zum Wert des Eigenheims zu addieren und der Gesamtwert zu bilden ist. Der Verordnungsgeber hat diesen Sonderfall in der Tarifstelle 4.1 zu einer Tätigkeit zusammengefasst.
Weitere Ausnahmen sind zur Einmessung von Doppel- und Reihenhäusern geregelt. Hier ist die Einmessung jedes Wohngebäudeteils einzeln als eine Tätigkeit auszuführen und abzurechnen. Die Sonderregelungen sind bei den Tarifstellen 2.2.2 und 7.1 zu beachten.
In den Fällen, in denen der alte Grenzverlauf eines Grundstücks mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.
Auch bei der Bereinigung von Überbauten ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.
Vermessungsunterlagen werden entweder von der Katasterbehörde, in der das zu vermessende Grundstück liegt, oder von der Vermessungsstelle, die den Antrag zur Liegenschaftsvermessung auszuführen hat, zweckgebunden erstellt und ausgefertigt. Bei Ausfertigung der Vermessungsunterlagen durch die Vermessungsstelle werden von der Katasterbehörde ggf. fehlende Unterlagen ergänzt, die digital im ANS nicht abrufbar sind. Für die Ergänzung fallen keine Gebühren an.
Die Tarifstelle ist ausgerichtet auf alle denkbaren Fallgestaltungen hoheitlicher Vermessungstätigkeit, für die Vermessungsunterlagen beantragt werden. Sie stellt auf das wirtschaftliche Vorhaben auf dem Grundstück des Antragstellers ab. Das kann zum Beispiel eine einzelne Maßnahme oder ein einzelnes Bauvorhaben sein.
Eine Besonderheit in Brandenburg ist die vermessungstechnische Betreuung von Bauvorhaben und damit verknüpft auch die Erstellung von Vermessungsunterlagen für verschiedene, zeitlich versetzte Vermessungsabschnitte auf verschiedenen Grundstücken. Hier sind für jedes Grundstück Vermessungsunterlagen zu beantragen. Weitere Folgevermessungen anderer Art können innerhalb von zwei Jahren mit den gleichen Vermessungsunterlagen ausgeführt werden. Hierfür ist eine Zweckerweiterung grundstücksweise zu beantragen. Mit der Zweckerweiterung ist keine neue Ausfertigung der Vermessungsunterlagen verbunden. Der Verantwortungszeitraum zur Aktualisierung der Vermessungsunterlagen “Jahre“ bezieht sich auf den Erstantrag. Dies schließt notwendige Nachlieferungen von Informationen, zum Beispiel aktuelle ALKIS-Daten nach der Fortführung der ersten Liegenschaftsvermessung ein. Erneute Gebühren fallen nicht an. Vermessungsunterlagen, die nach den alten Gebührensätzen ausgefertigt wurden (Ende der Amtshandlung) bleiben auch nach Änderungen der Tarife oder Tarifstellen für die Amtshandlung, für die sie ausgefertigt wurden, gültig; auf die Zweijahresfrist wird hingewiesen.
Bei kreisübergreifenden Vermessungen erteilt die Katasterbehörde die Vermessungsunterlagen bzw. die fehlenden Vermessungsunterlagen für den ÖbVI, in deren Amtsbereich der größere Teil des zu vermessenden Grundstücks liegt. Diese Katasterbehörde beschafft auch die notwendigen Vermessungsunterlagen von der benachbarten Behörde (Ergänzung). Die Ergänzung hat Priorität. Gebühren erhebt nur die Behörde, welche die Vermessungsunterlagen erteilt. Mit der benachbarten Behörde werden keine Gebühren verrechnet. Die Regelungen des Gebührenanspruchserlasses gelten insofern nicht. Bei länderübergreifenden Vermessungen gilt Vorstehendes sinngemäß. Mit den benachbarten Ländern bestehen entsprechende Vereinbarungen.
Vermessungsunterlagen für die Vermessung von Infrastrukturanlagen (Tarifstelle 4.2) werden stets nach Tarifstelle 2.2.3 abgerechnet. Eine Trassenverlängerung ist keine Zweckerweiterung und als neuer Antrag nach 2.2.3 abzurechnen.
Die Tarifstelle 2.2 ist nur anzuwenden, wenn Vermessungsunterlagen für die in dieser Tarifstelle genannten Tätigkeiten beantragt werden. Vermessungsunterlagen für andere, hier nicht genannte Tätigkeiten werden nach Tarifstelle 2.3 abgerechnet; einzelne Auszüge für private Zwecke werden nach Tarifstelle 2.1 abgerechnet.
Die Vermessung zum Grundflächen- und Höhennachweis (Tarifstelle 5.2) ist für sich keine hoheitliche Leistung und kann nur in Verbindung mit einer Liegenschaftsvermessung nach Tarifstelle 4.1 (Einmessung baulicher Anlagen) abgerechnet werden. Die Zweckbindung der Vermessungsunterlagen nach Tarifstelle 2.2.2 oder für die Zweckerweiterung nach Tarifstelle 2.2.8 (eine weitere Amtshandlung nach Tarifstelle 4.1) für die Einmessung baulicher Anlagen im Sinne der Tarifstelle 4.1 schließt die Nutzung der Unterlagen auch für den Grundflächen- und Höhennachweis ein.
Wird der Grundflächen- und Höhennachweis ohne die gleichzeitige Einmessung der baulichen Anlage ausgeführt, sind die Kosten für die Vermessung nicht nach der Vermessungsgebührenordnung zu berechnen. Das hierfür notwendige Vermessungszahlenwerk ist auf Antrag auszufertigen und nach Tarifstelle 2.3 abzurechnen.
Die Erweiterung des Verwendungszweckes von bereits erstellten Vermessungsunterlagen nach Tarifstellen 2.2.2 bis 2.2.6 zur Weiterverwendung dieser Vermessungsunterlagen ohne deren weitere Ergänzung für eine andere Vermessung nach Tarifstelle 4.1 bis 4.5 oder 5.1 auf dem Grundstück wird nach Tarifstelle 2.2.8 abgerechnet, ohne dass Vermessungsunterlagen neu ausgefertigt werden. Tarifstellen, die nicht zur Zweckerweiterung in Tarifstelle 2.2.8 aufgeführt sind, sind nach den Tarifstellen 2.2.2 bis 2.2.7 abzurechnen.
Bei gleichzeitiger Beantragung von Vermessungsunterlagen zu verschiedenen Tätigkeiten auf dem Grundstück, sind einmal die Vermessungsunterlagen nach der entsprechenden Tarifstelle 2.2.2 bis 2.2.6 abzurechnen und für jede weite gleichzeitig beantragte Tätigkeit dann nach Tarifstelle 2.2.8. Die Reihenfolge der einzelnen Tätigkeiten hängt von dem notwendigen Umfang der Vermessungsunterlagen ab, umfangreichste Vermessungsunterlagen sind zuerst zu fertigen. Zum Beispiel bei einem Antrag zu Vermessungsunterlagen für eine Teilungsvermessung (Tarifstelle 2.2.4) und für einen amtlichen Lageplan (Tarifstelle 2.2.4) sind die ersten Vermessungsunterlagen im Sinne der Teilungsvermessung zu erstellen.
Bei der Einmessung von baulichen Anlagen wird die Gebühr nach der Tarifstelle 2.2.8 für jede weitere Einmessung von baulichen Anlagen, auch wenn sie auf demselben Grundstück stehen, erhoben. Eine Ausnahme ist die gleichzeitige Einmessung des Einfamilienhauses und der dazugehörigen Wohnnebengebäude (Schuppen, Garage); wirtschaftliche Nebengebäude von Familienbetrieben (landwirtschaftlicher Stall, Werkstatt oder Lager des Familienbetriebes) gehören nicht zu den vorgenannten Wohnnebengebäuden.
Bei der Anwendung der Tarifstelle 2.2.4 wird für weitere gleichartige Vermessungen auf dem Grundstück, zur Abmarkung bestehender Grenzen, zum Grenzzeugnis oder zum amtlichen Lageplan jeweils eine Gebühr nach Tarifstelle 2.2.8 erhoben.
Vermessungsunterlagen für privatrechtliche Tätigkeiten
Gebühren und Preise für Vermessungsunterlagen für privatrechtliche Tätigkeiten, die nicht nach Tarifstelle 2.2 abgerechnet werden können, sind nach dieser Tarifstelle zu erheben.
Dies gilt beispielsweise für eine Grenzanzeige, Vermessungsarbeiten für die Erstellung von einfachen Planungsgrundlagen oder sonstiger Pläne, Bauwerksüberwachungen u.a.
Soweit Vermessungsunterlagen für Tätigkeiten, welche nicht nach den Tarifstellen 4 oder 5 abgerechnet werden, auszufertigen sind, so sind Gebühren nach dieser Tarifstelle sowie nach dem Vermessungsentgeltverzeichnis anzusetzen.
Die digitale Abgabe von ALKIS®-Daten ist mit der Gebühr nach dieser Tarifstelle abgegolten.
Die Aktualisierung von Auszügen nach dieser Tarifstelle ist nicht möglich. Es müssen neue Vermessungsunterlagen bestellt werden.
| Tarifstelle (Tst.) | Gegenstand | Gebühr Euro |
|---|---|---|
| 2.4 | Sonstige Unterlagen aus dem Liegenschaftskataster | |
| 2.4.1 | bis DIN A3, je Seite | 8 |
| 2.4.2 | größer als DIN A3 bis DIN A0, je Seite | 10 |
Sonstige Unterlagen
Dies sind alle anderen Unterlagen des Liegenschaftskatasters, die nicht als amtliche Auszüge nach der Tarifstelle 2.1, 2.2 oder 2.3 abgerechnet werden können.
Nach Tarifstelle 2.4 werden je abgegebene Seite einer Karte als Punktnummernübersicht, einer Grenzniederschrift, einem Auszug aus alten Kartennachweisen (Separationskarte, Urkarte, alte analoge Liegenschaftskarte usw.), einem Auszug aus Separationsrezessen, Gemarkungskarten usw. abgerechnet.
Unschädlichkeitszeugnisses
Zweck des Unschädlichkeitszeugnisses (§ 20 BbgAGBGB)
„(1) Das Eigentum an einem Teil eines Grundstücks kann frei von Belastungen übertragen werden, wenn durch ein behördliches Zeugnis festgestellt wird, dass die Rechtsänderung für die Berechtigten unschädlich ist.
(2) Unter der gleichen Voraussetzung kann ein dem jeweiligen Eigentümer eines anderen Grundstücks zustehendes Recht ohne Zustimmung derjenigen, zu deren Gunsten das andere Grundstück belastet ist, aufgehoben werden.
(3) Auf öffentliche Lasten finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung.“
Dem Gebührenrahmen 100 bis 750 Euro sind der Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der Wert und der sonstige Nutzen des Unschädlichkeitszeugnisses für den Antragsteller zu Grunde zu legen.
| Bedeutung, Wert, Nutzen | Verwaltungsaufwand | ||
| gering | mittel | hoch | |
| gering | 100 - 230 | 230 - 360 | 360 - 490 |
| mittel | 230 - 360 | 360 - 490 | 490 - 620 |
| hoch | 360 - 490 | 490 - 620 | 620 - 750 |
Bei mehreren Berechtigten ist für jeden Berechtigten eine Erstausfertigung des Unschädlichkeitszeugnisses in der Gebühr enthalten.
Verteilungsmaßstab
Die Regelung legt die Kriterien für die Aufteilung der Kosten fest, die nicht einem einzelnen Kostenschuldner aufzuerlegen sind - es sei denn, es besteht eine anders lautende Vereinbarung.
100 m Überschreitung
Die zwei auf dem Grundstück durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen werden als eine Liegenschaftsvermessung abgerechnet, wenn der Abstand von Grenzen oder Abmarkungen, die als Abrechnungsparameter in die Berechnung einfließen, in direkter Linie (Luftlinie) nicht weiter als 100 m zu Grenzen oder Abmarkungen der anderen Liegenschaftsvermessung, die als Abrechnungsparameter in die Berechnung einfließt, entfernt sind. Liegt die kürzeste Entfernung zwischen den Abrechnungsparametern der Liegenschaftsvermessungen weiter als 100 m auseinander, sind sie getrennt abzurechnen.
Bauliche Anlagen, Reihenhaus, Doppelhaus
Bauliche Anlagen sind dauerhaft errichtete Gebäude und Bauwerke, deren Nachweis im Liegenschaftskataster wegen ihrer Bedeutung als Liegenschaften erforderlich ist und dem Zweck der raumbezogenen Basisinformation des Liegenschaftskatasters dient. Im Verzeichnis der baulichen Anlagen werden die Anlagen aufgeführt, die im Sinne des § 8 Abs. 1 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes im Geobasisinformationssystem zur Erfüllung der Anforderungen des Rechts, der Verwaltung, der Wirtschaft oder der Gesellschaft darzustellen und zu beschreiben sind. Die Gebühr nach dieser Tarifstelle bezieht sich auf eine Amtshandlung “Einmessung baulicher Anlagen“. Eine Amtshandlung liegt auch bei baulichen Anlagen vor, die auf Grund ihrer Bauweise unterschiedliche Nutzungsteile haben, aber als eine bauliche Anlage errichtet wurden (z. B.: Bauernhaus - Wohnbereich und wirtschaftlicher Stall). Jede bauliche Anlage ist einzeln abzurechnen; das gleiche gilt auch für Nebengebäude; der Sonderfall “Eigenheim“ bleibt davon unberührt. Unabhängig von der Eigentumsstruktur ist jedes Reihenhaus einzeln abzurechnen.
Eigenheim
Nach Tarifstelle 4.1 Nummer 1 sind bei einem Eigenheim auch die Nebengebäude gleichzeitig einzumessen. Das heißt, die Liegenschaftsvermessung für die beantragten Einmessungen erfolgt in einem Arbeitsgang; als eine Tätigkeit.
Die gleichzeitige Einmessung des Eigenheims und der dazugehörigen Nebengebäude, die zum selben Eigenheim gehören, kann somit nur erfolgen, wenn die baulichen Anlagen einmessungsfähig sind und die Einmessung zeitgleich ausgeführt wird; andernfalls liegen hier zwei getrennte Tätigkeiten zur Einmessung vor.
Bei einem Baugebiet mit mehreren neuen Grundstücken ist die Vermessungsleistung für jede neue bauliche Anlage ggf. zusammen mit dem Nebengebäude einzeln abzurechnen.
Beispiel 1 zu Tst. 4.1
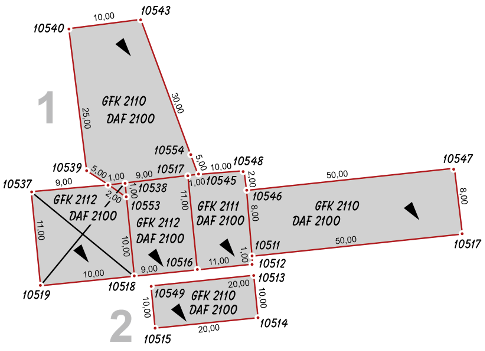
Weitere bauliche Anlagen
Mit Ausnahme von Eigenheimen und deren Nebengebäuden ist jede bauliche Anlage einzeln einzumessen. Von einer baulichen Anlage ist auch auszugehen, wenn innerhalb eines gemeinsamen Umrings unterschiedliche Nutzungen betroffen sind. Für die Gebührenberechnung ist der Wert für die durch den gemeinsamen Umring definierten baulichen Anlage zugrunde zu legen. Eine Überdachung stellt grundsätzlich keinen gemeinsamen Umring zwischen zwei baulichen Anlagen her.
Im Beispiel hat die obere bauliche Anlage eine in sich geschlossene Außenlinie (Umring). Die Überdachung (hier einmessungspflichtig) selbst kann mit der baulichen Anlage zusammen eingemessen werden. In der Skizze sind zwei bauliche Anlagen einzumessen. Anbauten erweitern den Umring einer baulichen Anlage. Bei mehreren neuen Anbauten an einer bestehenden baulichen Anlage ist für die Gebührenberechnung der Gesamtwert der Anbauten zu bilden.
Quadratwurzel
Die Quadratwurzel ist immer von dem nächst höheren durch 500 000 € teilbaren Wert der baulichen Anlage zu ziehen und mit 1,25 zu multiplizieren. Das Ergebnis ist nicht zu runden.
Beispiel 2 zu Tst. 4.1
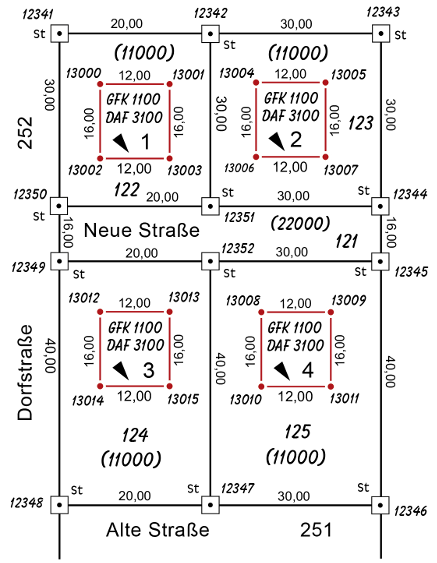
Beantragt wird vom Investor die Einmessung der errichteten baulichen Anlagen. Hier sind mehrere bauliche Anlagen einzumessen. Die aktuellen bzw. zukünftigen Eigentumsverhältnisse bleiben außer Betracht.
Gebührenberechnung:
Vorbereitung (1 x Tst. 2.2.2 und 3 x Tst. 2.2.8)
Wert je bauliche Anlage 150 000 Euro
Gebühr je bauliche Anlage: 550 Euro
zuzüglich Umsatzsteuer
Übernahme (4 x Tst. 7.1)
Infrastrukturanlagen
Diese Tarifstelle ist eine Sonderregel und berücksichtigt die Besonderheiten für Vermessungen an Infrastrukturanlagen. Infrastrukturanlagen sind trassenförmige Anlagen, die dem Verkehr dienen, wie auch trassenförmige Anlagen, die der Ver- oder Entsorgung mit Energie oder anderen Medien oder Materialien sowie dem Schutz dienen. Dazu gehört zum Beispiel auch die Erdölleitung, die eine Raffinerie mit Rohstoff (und nicht mit Energie) versorgt. Damit ist diese Leitung eine Versorgungsleitung für einen Rohstoff und sie wird als eine Trasse geplant.
Grundsätzlich sind Grenzfeststellungen, Vermessungen zu Abmarkungen und Vermessungen zum Grenzzeugnis sind in Verbindung mit dieser Art Anlagen nach dieser Tarifstelle abzurechnen.
Es wird immer das ganze Flurstück einer Kategorie zugeordnet, auch wenn nur ein Teil des Flurstücks von der Kategorie selbst betroffen ist. Befinden sich mehrere Infrastrukturanlagen unterschiedlicher Kategorien auf einem Flurstück, ist immer die höhere Kategorie für das ganze Flurstück maßgebend.
In einem Antrag sind die Grenzlängen alle zu summieren und dann abschließend aufzurunden. Die anrechenbare Summe der Grenzlängen beträgt mindestens 100 m. Zwischen den einzelnen Grenzen dürfen Lücken entstehen. Eine einzelne Lücke darf aber 100 m (Trassenlänge) nicht überschreiten. Grenzen, die zwischen Flurstücken unterschiedlicher Kategorien gebildet werden, sind der höheren Kategorie zuzuordnen. Wenn die Summe der anzurechnenden Grenzen aller Kategorien die Mindestgrenzlänge nicht erreicht (z. B. Kategorie II 50 m und Kategorie III 30 m), ist die zu ergänzende Länge (Rest 20 m) nach der höchsten Kategorie des Antrags (im Beispiel Kategorie II) abzurechnen. Wird die Mindestgrenzlänge überschritten, sind die Grenzen in den einzelnen Kategorien abzurechnen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Grenzen in der einzelnen Kategorie selbst die Länge von 100 m nicht erreichen.
Vermessungen an Straßenausbuchtungen, wie zum Beispiel Bushaltestellen, unbewirtschaftete Park- und Rastplätze oder privat genutzte Ausbuchtungen, sind untergeordnete (unselbstständige) Teilflächen der Infrastrukturanlage Straße, die von der Natur der Anlage her trassenförmig sind.
Bei Autobahnen und ähnlich ausgebauten Bundesstraßen gehören die Flächen von Tankstellen, Rasthäusern, Rasthöfen oder bewirtschafteten Parkplatzanlagen etc., die mit der Autobahn bzw. Bundesstraße durch eine Zu- bzw. Abfahrt verbunden sind auch zu den Infrastrukturanlagen, die nach Tarifstelle 4.2 abgerechnet werden, weil auch sie untergeordnete (unselbstständige) Teilflächen der Infrastrukturanlage Straße sind.
Vermessungen an Gebieten für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen von Infrastrukturanlagen sind nicht mit dieser Tarifstelle abzurechnen. Diese Gebiete sind regelmäßig keine trassenförmigen Anlagen. Sie sind nach Tarifstelle 4.3 abzurechnen. Ausnahmen bilden trassenbegleitende Ersatz- und Ausgleichanlagen.
Mit den Tarifstellen 4.2.1 bis 4.2.3 (Kategorien I bis III) sind die Fahrbahnen, Gewässerflächen, Gleisbetten und Haupttrassen der Ver- bzw. Entsorgungsanlage abzurechnen. Die Begleitflächen (Rad- und Gehwege, Böschungen, Gräben, Deiche u. ä.) gehören zu der Kategorie der Straße, wenn sie die Straße annähernd parallel begleiten. Andernfalls sind sie sonstige Infrastrukturanlagen und nach Kategorie IV abzurechnen. Die Länge der gemeinsamen Flurstücksgrenze zwischen der höheren Kategorie und der Kategorie IV ist nur einmal nach der höheren Kategorie anzusetzen (Allgemeine Regel zu Tst. 4.2, Nr. 3).
Die Allgemeine Regelung Nr. 2 zu Tarifstelle 4.2 stellt klar, dass die Bildung von Verkehrs- und Gewässeranlagen, die im Zuge eines Wohn-, Gewerbe- oder Industriebauvorhabens entstehen, nach Tarifstelle 4.3 abzurechnen sind.
Neu entstehende Flurstücke
Beispiel 1 zu Tst. 4.2
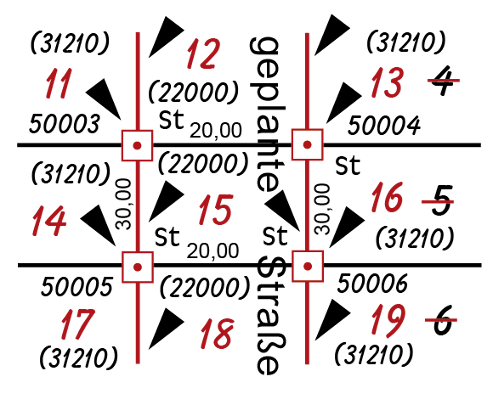
Für die Gebührenberechnung zählen alle neuen Flurstücke. Das nebenstehende Beispiel 1 weist neun neue Flurstücke aus. Flurstücke, die bei Vermessungen an Infrastrukturanlagen gebildet werden, selbst aber nicht zu den Infrastrukturanlagen zählen, sind der jeweils angrenzenden Kategorie der Infrastrukturanlage zuzuordnen.
Beispiel 2 zu Tst. 4.2
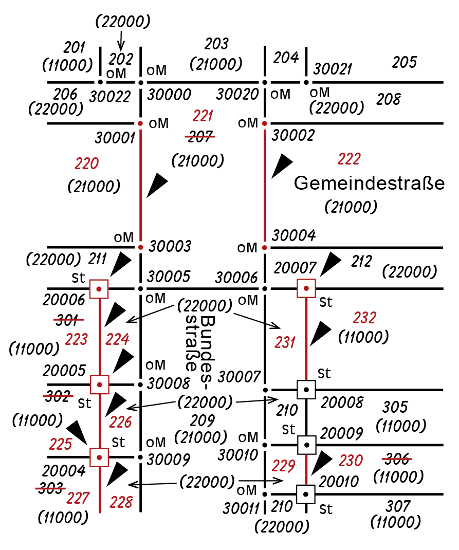
Beantragt sind zum einen die Teilungsvermessungen der Fahrbahn an der Kreuzung Bundes-/Gemeindestraße und der Gehweg auf beiden Seiten der Bundesstraße. Der Gehweg liegt innerhalb der geschlossenen Ortschaft und ist damit grundsätzlich als Gemeindestraße einzuordnen. Nur wenn ein Geh- oder Radweg, wie hier im Beispiel dargestellt, parallel zur Bundesstraße gebaut wird, ist der Weg ein Teil der Bundesstraße und ist mit der Kategorie II Bundesstraße abzurechnen.
Für die Gebührenberechnung sind zu berücksichtigen:
| Tst. 4.2.2 Kategorie II Bundesstraße | |
| Grenzlängen: | alle neuen Grenzen |
| 11 neue Flurstücke | 221, 223 bis 323 |
| Tst. 4.2.3 Kategorie III Gemeindestraße | |
| 2 neue Flurstücke | 220 und 222 |
Die Summe der Grenzlängen muss mindestens 100 m betragen.
Sockelbetrag
Bei dieser Tarifstelle sowie den folgenden bis Tarifstelle 4.6 greift die Grundstückssicht der Gebührenordnung. Grundsätzlich ist jedes Grundstück einzeln abzurechnen, der Sockelbetrag ist bei jedem Grundstück festzusetzen.
Können alle abrechnungsrelevanten Parameter einem Grundstück zugeordnet werden (z. B. Grenzfeststellung einer bestehenden Grenze), ist grundsätzlich der Sockelbetrag nur für ein Grundstück abzurechnen.
In den Fällen, in denen der alte Grenzverlauf eines Grundstücks mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.
Auch bei der Bereinigung von Überbauten ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.
Bodenwert
Die Bodenwertstufe “bis 30 Euro“ schließt den Bodenrichtwert 30 Euro ein.
Grenzfeststellung
Grundsätzlich sind die Längen der Grenzen in voller Länge für die Gebührenberechnung anzurechnen. Ausnahmen gibt es zum einen bei den Längen bestehender Grenzen, in die neue Grenzen einmünden. Die anrechenbare Länge ist auf maximal 160 m Länge begrenzt. Dabei ist es nicht relevant, ob die bestehende Grenze festgestellt oder wiederhergestellt werden muss. Mit der Gebühr ist die ganze Länge der Grenze abgerechnet. Eine nochmalige Abrechnung dieser Grenze, weil weitere neue Grenzen einmünden oder weil am Ende der Grenzpunkt abgemarkt werden soll, ist nicht möglich. Es bleibt keine Teillänge übrig, die mit einer anderen Gebühr für Grenzlängen (z. B. mit Tst. 4.4 oder Tst. 4.5) abgerechnet werden kann. Auch wenn mehrere neue Grenzen in eine bestehende Grenze einmünden, ist die bestehende Grenze, in die eine neue Grenze einmündet, mit der ersten neuen Grenze ganz abgerechnet; für die anderen neuen Grenzen ist hier keine bestehende Grenze mehr abzurechnen.
Zum anderen ist die Länge der Grenze zwischen zwei direkt benachbarten Grenzpunkten auf maximal 500 m abrechenbare Länge begrenzt.
Die Gebühr nach dieser Tarifstelle bezieht sich auf eine Amtshandlung zur Feststellung neuer oder bestehender Grenzen, die in einem örtlichen und sachlichen Zusammenhang stehen.
Wenn eine Grenze mehr als einen Bodenwert berührt, ist der Gebührenberechnung der höchste der betreffenden Bodenwerte zu Grunde zu legen. Berührungen in nur einem Punkt bleiben außer Betracht.
Beispiel 1 zu Tst. 4.3
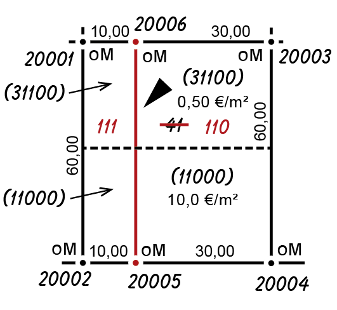
anzuhaltender Bodenwert
- Grenze 20005-20006 = 10,00 €/m²
- Grenze 20001-20003 = 0,50 €/m²
- Grenze 20002-20004 = 10,00 €/m²
Beispiel 2 zu Tst. 4.3:
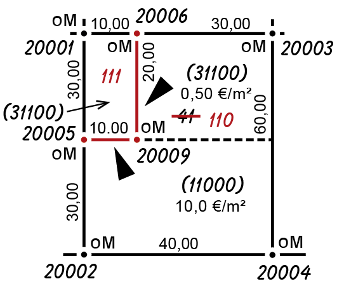
anzuhaltender Bodenwert
- Grenze 20006-20009 = 0,50 €/m²
- Grenze 20005-20009 = 10,00 €/m²
- Grenze 20001-20003 = 0,50 €/m²
- Grenze 20001-20002 = 10,00 €/m²
Die bestehende Grenze, in die eine neue Grenze einmündet, ist für die Gebührenberechnung als eine Grenze anzusehen. Die neue Grenze teilt die Länge der bestehenden Grenze nicht auf. Liegt die bestehende Grenze an unterschiedlichen Bodenwerten an, ist der höhere Bodenwert für die Gebührenberechnung anzuhalten.
Eingebrachte Abmarkung
Die Tarifstelle 4.3.2 ist nur in Verbindung mit der Liegenschaftsvermessung nach Tarifstelle 4.3.1 für das Einbringen einer Abmarkung in die festzustellenden Grenzen anzuwenden. Sie ist nur für “eingebrachte“ Grenzzeichen zu erheben. Für örtlich vorgefundene Grenzzeichen oder Grenzeinrichtungen, die zur Abmarkung erklärt werden, ist keine Gebühr nach Tarifstelle 4.3.2 zu erheben. Eine Gebäudeecke oder Zaunsäule wird nicht in die Grenze eingebracht. Sie wird nur als Grenzzeichen gewidmet. Die Widmung ist mit der Gebühr nach Tarifstelle 4.3.1 abgegolten. Mit der Tarifstelle 4.3.2 können nur Grenzpunkte festzustellende neue bzw. bestehende Grenzen abgerechnet werden. Grenzpunkte bestehender festgestellter Grenzen, in die neue Grenzen einmünden, müssen nach Tst. 4.5 abgerechnet werden.
Beispiel 3 zu Tst. 4.3:
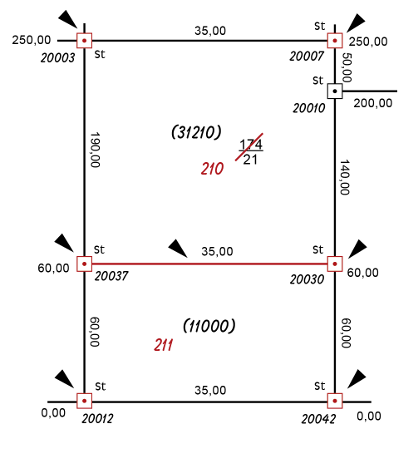
Bildung einer neuen Grenze vom Punkt 20030 nach Punkt 20037 (einschließlich Abmarkung) sowie, die Abmarkung der Punkte 20003, 20007 und 20012. Die bestehenden Grenzen sind festgestellt.
Bei kombinierten Anträgen sind zuerst die Amtshandlung der Grenzfeststellung mit der dazugehörigen Abmarkung der betroffenen Grenzpunkte (Tst. 4.3), danach die Amtshandlungen der Abmarkung der Grenzpunkte, der nicht von der Grenzfeststellung betroffenen Grenzen abzurechnen.
Gebührenberechnung (angenommener Bodenwert 60 €/m²):
Grenzfeststellung
- Tst. 2.2.4
- Vermessungsunterlagen für Tätigkeiten nach Tst. 4.3 175,00 €
- Tst. 4.3.1
- Sockelbetrag einmalig 700,00 €
- Grenzlängengebühr für 355 m (100 %, je 9,00 €) 3195,00 €
- § Grenzlänge 20037-20030 mit 35 m sowie 20012-20003 mit 250 m und 20042-20010 mit 200 m
anrechenbar bei dieser Tarifstelle ist bei den Grenzen 20012-20003 sowie 20042-20010 je 160 m
(Damit sind die Längen beider Grenzen 20012-20003 und 20042-20010 ganz abgerechnet.)
- § Grenzlänge 20037-20030 mit 35 m sowie 20012-20003 mit 250 m und 20042-20010 mit 200 m
- Tst. 4.3.2
- Abmarkung für 2 Punkte (100 %, je 30,00 €) 60,00 €
- § Abmarkungen der neuen Grenzpunkte 20037 und 20030
- Abmarkung für 2 Punkte (100 %, je 30,00 €) 60,00 €
Abmarkung
- Tst. 2.2.8
- Erweiterung des Verwendungszwecks der erteilten Vermessungsunterlagen 60,00 €
- Erweiterung für die Abmarkungen der bestehenden Grenzen auf dem Grundstück.
- Erweiterung des Verwendungszwecks der erteilten Vermessungsunterlagen 60,00 €
- Tst. 4.5
- Grenzwiederherstellung für 35 m (Grenze 20003-20007 - 90 % von Tst 4.3.1 - je 8.10 €) 283,50 €
- § Je eine anliegende Grenze muss wieder hergestellt werden. Die Grenzen 20012-20037 und 20037-20003 sind bereits mit der gleichzeitig ausgeführten Grenzfeststellung wieder hergestellt und nach Tst. 4.3.1 abgerechnet worden. Eine erneute Abrechnung dieser Grenzen ist mit dieser kombinierten Liegenschaftsvermessung nicht zulässig; sie werden auch nur einmal im Zuge dieser Liegenschaftsvermessung von der Vermessungsstelle wiederhergestellt. Auch der Sockelbetrag ist hier nicht zu erheben. Nur für den Grenzpunkt 20007 ist noch eine Grenze 20003-20007 (35 m) oder 20007-20010 (50 m) wiederherzustellen.
- Abmarkung für 3 Punkte (90 % von Tst 4.3.2, je 27,00 €) 81,00 €
- Grenzwiederherstellung für 35 m (Grenze 20003-20007 - 90 % von Tst 4.3.1 - je 8.10 €) 283,50 €
- Tst. 7.2
- Übernahme für 2 neue Flurstücke (je 170,00 €) 340,00 €
- § Mit der Übernahme nach Tarifstelle 7.2 ist auch die Übernahme der gleichzeitig ausgeführten Liegenschaftsvermessung nach Tarifstelle 4.5 gebührenmäßig abgegolten.
- Übernahme für 2 neue Flurstücke (je 170,00 €) 340,00 €
Grenzlänge
Bei der Vermessung an Flurstücksgrenzen sind neben den Längen der neuen Grenzen auch die Längen der bestehenden Grenzen anzurechnen, in die die neuen Grenzen einmünden. Die Längen bestehender Grenzen sind komplett wiederherzustellen, jedoch nur maximal bis zu einer Länge von 160 m gebührentechnisch anrechenbar. Diese Maximallänge gilt auch, wenn Grenzen über 160 m zwingend festgestellt werden müssen.
Die Kostenberechnung kann selbst bei kombinierten Amtshandlungen jede Grenzlänge nur einmal berücksichtigen. Nach Feststellung der Längen aller gebührenrelevanten Grenzlängen des Antrags werden diese summiert. Das Ergebnis ist die Grundlage zur Berechnung der Grenzlängengebühr.
Beispiel 4 zu Tst. 4.3
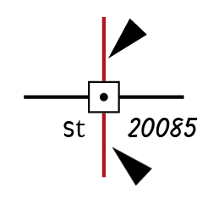
Beginnt oder endet eine neue Grenze in einem bestehenden Grenzpunkt, sind pauschal 15 m Länge der bestehenden Grenzen anzurechnen. Auch wenn mehrere neue Grenzen auf demselben bestehenden Grenzpunkt beginnen oder enden, ist die Mindestgrenzlänge nur einmal anzusetzen, da der Aufwand für den Grenzpunkt nur einmal entsteht.
Beispiel 5 zu Tst. 4.3
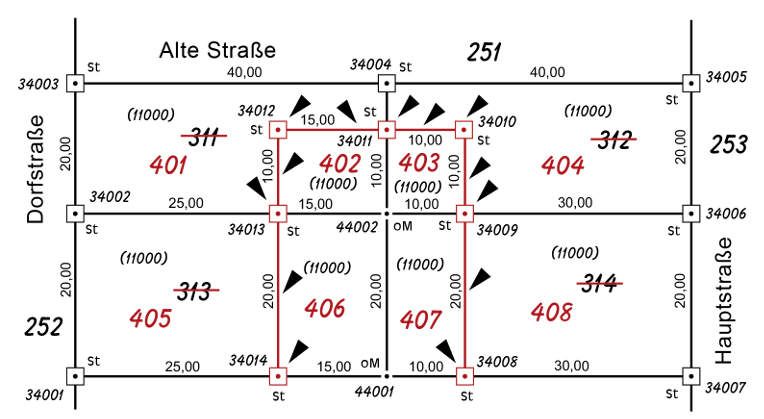
Beantragt ist die Bildung eines Bauplatzes. Die Grundstücke gehören verschiedenen Eigentümern. Die Flurstücke 311 und 312 bilden ein Grundstück. Die Flurstücksgrenzen sind festgestellt. Die alten Grenzen bleiben bestehen. Auf die Abmarkung der neuen Grenzpunkte wird nicht verzichtet.
Die Gebühr ist für den ganzen zusammenhängenden Auftrag zu ermitteln. Dabei sind die betroffenen Grenzen nur einmal gebührenmäßig anzurechnen. Für jedes Grundstück ist die Gebühr für Vermessungsunterlagen (Tst. 2.2.4) für den Sockelbetrag (Tst. 4.3.1) und für die Übernahme (Tst. 7.2) festzusetzen. Die Grenzen können im Auftrag grundstücksunabhängig ermittelt werden. Die Gebühren sind komplett vom Antragsteller als Gebührenschuldner zu erheben oder alternativ von den begünstigten Eigentümern entsprechend der allgemeinen Regelung zu Tarifstelle 4, Nr. 2 (… Gebühren auf mehrere Kostenschuldner zu verteilen, so dienen bei Flurstücken die Flächenanteile der neuen Flurstücke … für jeden Kostenschuldner als Verteilungsmaßstab, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.).
Sollten die Gebühren nicht vom Antragsteller als Kostenschuldner eingefordert werden können, sind die Gebühren auf die Grundstückseigentümer zu verteilen. Hier ist die Allgemeine Regelung Nr. 2 zu Tst. 4 anzuwenden.
Die Gebühren berechnen sich für das Beispiel 5 wie folgt:
- Gebühr je Grundstück
- 3 x Vermessungsunterlagen (Tst. 2.2.4)
- Grundstück 1 (Flurstücke 311 und 312)
- Grundstück 2 (Flurstück 313)
- Grundstück 3 (Flurstück 314)
- 3 x Sockelbetrag (Tst. 4.3.1)
- 3 x Vermessungsunterlagen (Tst. 2.2.4)
- Gebühr je zusammenhängenden Auftrag
- Grenzlängen (Tst. 4.3.1):
- bestehende Grenzen, in die neue Grenzen einmünden (je Grenze mindestens 15 m, maximal 160 m)
Grenzen 34002-44002; 34006-44002; 34001-44001; 34007-44001; 34004-44002 - neue Grenzen (je Grenze maximal 500 m)
Grenzen 34008-34009; 34009-34010; 34010-34011; 34011-34012; 34012-34013; und 34013-34014
- bestehende Grenzen, in die neue Grenzen einmünden (je Grenze mindestens 15 m, maximal 160 m)
- Abmarkung - es wurde nicht darauf verzichtet (Tst.4.3.2)
7 Grenzpunkte 34008; 34009; 34010; 34011; 34012; 34013 und 34014
- Grenzlängen (Tst. 4.3.1):
- Übernahme
- Tst.7.2 - Flurstücke (8x)
- Grundstück 1: 4 Flurstücke (401, 402, 403 und 404)
- Grundstück 2: 2 Flurstücke (405 und 406)
- Grundstück 3: 2 Flurstücke (407 und 408)
- Tst.7.2 - Flurstücke (8x)
Beispiel 6 zu Tst. 4.3
Variante 1
Die Flurstücke 145 und 146 bilden zwei Grundstücke und haben unterschiedliche Eigentümer. Beantragt ist die Begradigung der gemeinsamen, nicht festgestellten Grenze. Grenzpunkt 58005 liegt fest, die Grenze 58005-58006 wird im Einvernehmen mit den Beteiligten festgelegt. Die bestehenden Grenzen 58001- 58002-58004-58005 sollen künftig wegfallen. Die Voraussetzung für eine Verschmelzung der bestehenden Grenzen ist nach der grundbuchrechtlichen Zuschreibung der neuen Flurstücke zum jeweiligen Grundstück gegeben. Eine zustimmende grundbuchrechtliche Voranfrage liegt vor. Die Beteiligten verzichten auf die Grenzuntersuchung der gemeinsamen bestehenden Grenzen sowie die Abmarkung der Grenzlinie 58002-58003-58004, sind damit einverstanden, den Katasternachweis der Fortführung zu Grunde zu legen (VVLiegVerm Nr. 6.1.1) und dass der Schnittpunkt (2) sowie die Flächengrößen nur grafisch ermittelt werden. Die Straßengrenzen sind festgestellt.
In diesem Fall, in dem der alte Grenzverlauf der Grundstücke mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.
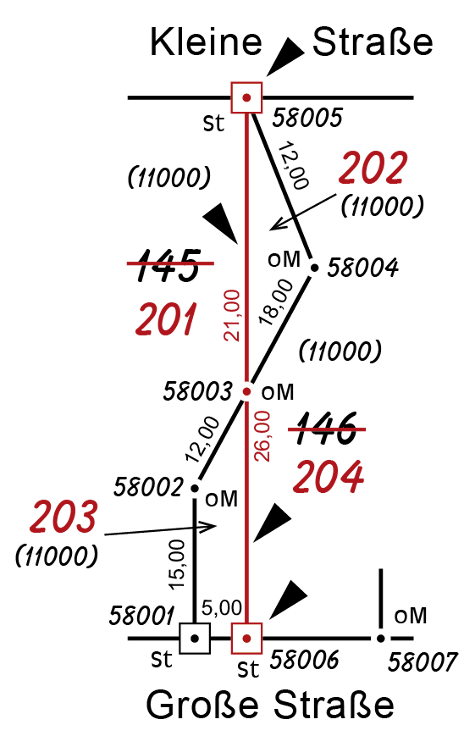
Die Gebühren sind zu berechnen:
- je Grundstücke (145 und 146)
- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (1x)
- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (1x)
- je Auftrag
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen
- bestehende Grenzen
Grenzen 58001-58007
Mindestgrenzlänge im Punkt 58005 - neue Grenzen
Grenzen 58003-58005; 58003-58006
- bestehende Grenzen
- Tst. 4.3.2 Abmarkung
- neue Grenzpunkte (2x)
Grenzpunkte 58001, 58005
- neue Grenzpunkte (2x)
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen
- Übernahme
- Tst. 7.2 Flurstücke (4x)
Variante 2
Wird ein flächengleicher Grenzausgleich beantragt, so ist dies eine Zwangsbedingung, welche die Feststellung der gemeinsamen bestehenden Grenzen voraussetzt. Eine Verzichtserklärung der Beteiligten auf die Grenzuntersuchung würde dem Antrag entgegenstehen.
Die neue Grenze endet in dem bestehenden Grenzpunkt 58005; die Länge der bestehenden Einmündungsgrenze “Kleine Straße“ ist mit der Mindestgrenzlänge von 15 m anzurechnen. Auf Grund des genauen Flächenausgleiches muss die bestehende Grenzlinie 58001- 58002-58004-58005 festgestellt werden; auf die Abmarkung der Grenzpunkte 58002, 58003, 58004 und 58005 wird verzichtet. Der Grenzpunkt 58003 muss gebildet werden.
In den Fällen, in denen der alte Grenzverlauf eines Grundstücks mit dem Ziel des wechselseitigen Austausches von Flächen durch einen neuen Grenzverlauf ersetzt werden soll (Grenzausgleich), ist von der Vermessung auf einem Grundstück auszugehen.
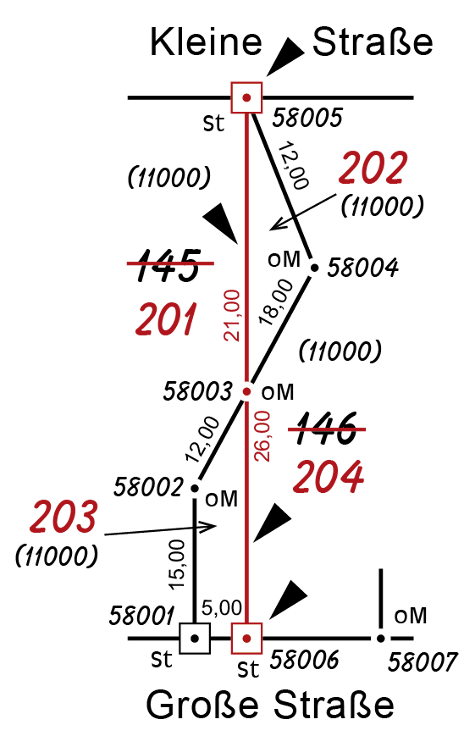
Die Gebühren sind zu berechnen:
- je Grundstücke (145 und 146)
- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (1x)
- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (1x)
- je Auftrag
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen
- bestehende Grenzen
Grenzen 58007 - 58001 - 58002 - 58004 - 58005
Mindestgrenzlänge im Punkt 58005 - neue Grenzen
Grenzen 58003 - 58006; 58003 - 58005
- bestehende Grenzen
- Tst. 4.3.2 Abmarkung
- neue Grenzpunkte (2x)
Grenzpunkte 58005, 58006
- neue Grenzpunkte (2x)
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen
- Übernahme
- Tst. 7.2 Flurstücke (4x)
Beispiel 7 zu Tst. 4.3 in Kombination mit Tst. 4.4 und Tst. 4.5
Der Antragsteller beantragt das Flurstück 118 zu zerlegen und die Grenzen 51003 - 51004, 51004 - 51005 wiederherzustellen; alle Grenzpunkte sollen abgemarkt werden.
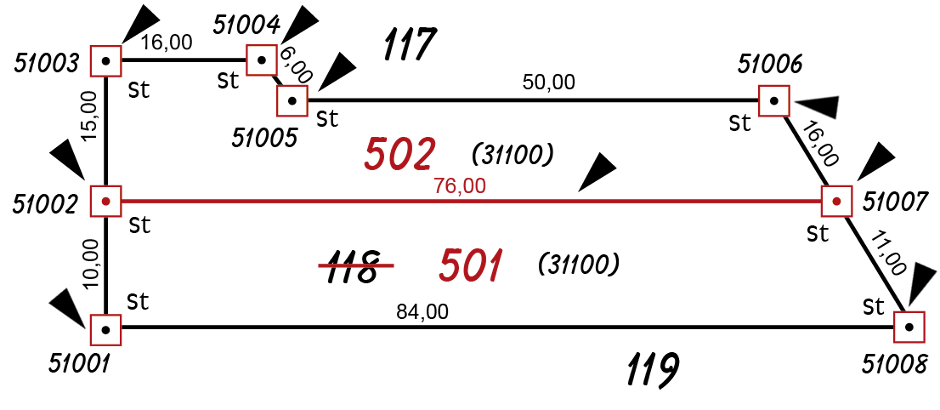
Die Vermessungsstelle muss den Antragsteller über die verwaltungsrechtliche Umsetzung seines Antrags informieren. Er ist auf Folgendes hinzuweisen, dass auf dem Kostenbescheid
- die Zerlegung des Flurstücks 118 als Grenzfeststellung (Tarifstelle 4.3),
- die Abmarkung auch die Grenzwiederherstellung der abzumarkenden Grenzen beinhaltet (Tarifstelle 4.5) und
- die Wiederherstellung der Grenze 51003 - 51004 ein Grenzzeugnis wäre (Tarifstelle 4.4), wenn denn der Antragsteller den Katasternachweis zum örtlichen Grenzverlauf untersucht haben möchte. Wenn nicht, wäre die Grenzwiederherstellung nicht zu beantragen. Die Abmarkung erfolgt hier bereits indirekt durch die Abrechnung der Abmarkungen der Grenzen 51001 - 51003 und 51004 - 51005. Hier beantragt der Antragsteller das Grenzzeugnis, wegen Überprüfung der Grenzeinrichtungen und der grenznahen Bebauung.
Die Flurstücksgrenzen 51001 - 51008, 51001 - 51003, 51003 - 51004, 51004 - 51005, 51005 - 51006, 51006 - 51008 (84 m; 25 m; 16 m; 6 m, 50 m; 27 m) sind festgestellt. Sie müssen für den Antrag wiederhergestellt und die neue Grenze (76 m) muss festgestellt werden. Der Bodenwert beträgt 30 Euro/m². Zerlegung und Grenzwiederherstellung einschließlich der Abmarkungen sind ein Arbeitsvorgang.
Für die Gebührenberechnung sind zu berücksichtigen:
- Grundstücke (Flurstück 118)
- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (1x)............................................ 175,00 €
- Tst. 2.2.8 Zweckerweiterung (2x)..................................................... 120,00 €
- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (1x)............................................................ 700,00 €
- Antrag
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen 128 m 1024,00 €
- bestehende Grenzen 52 m
Grenze 51001 - 51003, 51006 - 51008 - neue Grenzen 76 m
Grenzen 51002 - 51007
- bestehende Grenzen 52 m
- Tst.4.3.2 Abmarkung........................................................................ 60,00 €
- neue Grenzunkte (2x)
Grenzpunkte 51002, 51007
- neue Grenzunkte (2x)
- Tst 4.5 Abmarkung........................................................................ 205,20 €
- Grenzwiederherstellung 6 m
Bestehende Grenze 51004 - 51005 (Die Grenzlängen 51006 - 51008 und 51001 - 51003 sind bereits mit Tst. 4.3.1 abgerechnet; bei einer kombinierten Vermessung kann jede Grenze nur einmal angerechnet werden, auch wenn sie mehrfach betroffen ist; sie wird auch nur einmal wiederhergestellt.) - Abmarkungen (6x)
- Grenzwiederherstellung 6 m
- Tst 4.4 Grenzzeugnis..................................................................... 70,40 €
- Grenzwiederherstellung 16 m
bestehende Grenze 51003 - 51004 (Die Grenzen 51005 - 51006 und 51001 - 51008 sind nicht anzurechnen, weil sie nicht beantragt wurden.)
- Grenzwiederherstellung 16 m
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen 128 m 1024,00 €
- Übernahme
- Tst. 7.2...................................................................................... Flurstücke (2x) 320,00 €
Beispiel 8 zu Tst. 4.3 - Vermessungsauftrag zu mehreren nachbarschaftlichen Grundstücken eines Investors
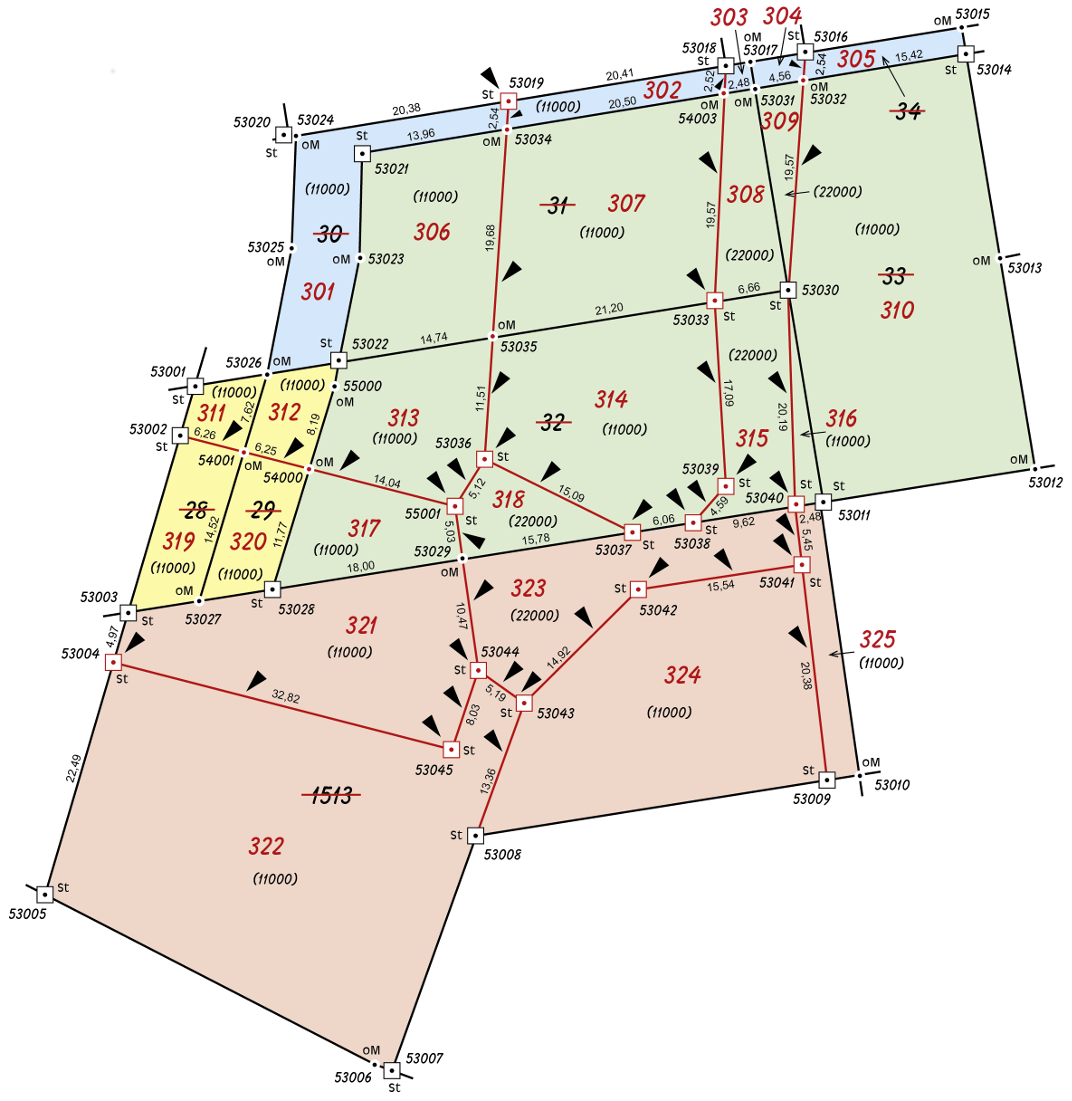
Auf einer Brachfläche, die aus vier Grundstücken besteht, sollen mehrere neue Grundstücke sowie die Zuwegung, wie nebenstehend dargestellt, entstehen. Die bestehenden Grenzen gelten als festgestellt. Der Bodenrichtwert liegt in diesem Gebiet bei 55,00 €/m². Der Antragsteller verzichtet teilweise auf die Abmarkung der neuen Grenzpunkte.
Die Vermessungsunterlagen sind je Grundstück auszufertigen. Die Zweckerweiterung nach Tarifstelle 2.2.8 ist hier nicht anzuwenden, weil die Liegenschaftsvermessung auf einem anderen Grundstück weiter ausgeführt wird.
Der Sockelbetrag ist für jedes Grundstück einmal zu erheben. Die Grenzlängengebühr kann grundstücksunabhängig für den ganzen Auftrag ermittelt werden. Dabei sind die bestehenden Grenzen des Auftrags nur einmal als Gebühr anzusetzen, auch wenn dort mehrere neue Grenzen einbinden. Die Maximallänge von 160 m je bestehender Grenze ist zu beachten.
Mit der Übernahme werden alle neuen Flurstücke abgerechnet. Sie sind den Grundstücken zuzuordnen.
Sollten die Gebühren nicht vom Antragsteller als Kostenschuldner eingefordert werden können, sind die Gebühren auf die Grundstückseigentümer zu verteilen. Hier ist die Allgemeine Regelung Nr. 2 zu Tst. 4 anzuwenden.
Der Auftrag ist wie folgt abzurechnen:
- Grundstücke je Grundstück (Flurstücke 28 und 29, Flurstücke 30 und 34;
Flurstück 31, 32 und 33 sowie Flurstück 1513)- Tst. 2.2.4 Vermessungsunterlagen (4x 175 €)..................... 700,00 €
- Tst. 4.3.1 Sockelbetrag (4x 700 €)..................................... 2.800,00 €
- Antrag
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen 650 m à 9 €................................. 5.850,00 €
- bestehende Grenzen 297,75 m
- neue Grenzen 261,81 m
- Mindestgrenzlänge 90,00 m (in sechs Punkten)
- Tst. 4.3.2 Abmarkung 14x 30€ 420,00 €
- neue Grenzpunkte (14x)
- Tst. 4.3.1 Grenzlängen 650 m à 9 €................................. 5.850,00 €
- Übernahme
- Tst. 7.2 neue Flurstücke 25x 170 €.................................. 4.250,00 €
- Grundstück 1: 4 Flurstücke (311, 312, 319 und 320)
- Grundstück 2: 5 Flurstücke (301 - 305)
- Grundstück 3: 11 Flurstücke (306 - 310 und 313 - 318)
- Grundstück 4: 5 Flurstücke (321 - 325)
- Tst. 7.2 neue Flurstücke 25x 170 €.................................. 4.250,00 €
Gesamtgebühr für den Auftrag:........................................................... 14.020,00 €
Grenzzeugnis
Das Grenzzeugnis wird dem Antragsteller erteilt (Nr. 6.3 VVLiegVerm). Für die Anwendung dieser Tarifstelle müssen Grenzpunkte in der Örtlichkeit nicht abgemarkt sein.
Eine Abmarkung der Grenzpunkte ist bei einem Grenzzeugnis aber nicht möglich. Sollte im Laufe der örtlichen Vermessung die Abmarkung eines Grenzpunktes beantragt werden, ist der Antrag für diesen Punkt in ein Abmarkungsverfahren umzuwandeln und die Gebühr für diesen Punkt nach Tst. 4.5 abzurechnen.
Können alle abrechnungsrelevanten Parameter einem Grundstück zugeordnet werden (z. B. Grenzzeugnis für eine bestehende Grenze), ist grundsätzlich der Sockelbetrag nur für ein Grundstück abzurechnen.
Abmarkung
Es sind alle Regelleistungen gemäß Nr. 6.4 VVLiegVerm in Verbindung mit Nr. 6.1 VVLiegVerm zu erbringen. Die Abmarkung ist die rechtswirksame Kennzeichnung der Grenzpunkte einer festgestellten Grenze mit einem Grenzzeichen im Sinne des § 15 BbgVermG. Die Tarifstelle 4.5 ist nicht mit den Regelleistungen der Tarifstelle 4.3.2 zu verwechseln, die gemäß Nr. 6.2 VVLiegVerm in Verbindung mit Nr. 6.1 VVLiegVerm eine Abmarkung nur im Zusammenhang mit der Feststellung von Grenzen (Tarifstelle 4.3.1) abrechnet.
Es kann nur die Abmarkung einer wiederhergestellten Grenze abgerechnet werden. Im Zuge der Abmarkung mehrerer Grenzpunkte eines Grundstücks nach Tarifstelle 4.5 sind immer die Längen der Grenzen zwischen den abzumarkenden Grenzpunkten gebührentechnisch zu berücksichtigen. Liegen die abzumarkenden Grenzpunkte an unterschiedlichen Grenzen des Antragsgrundstücks, ist die Länge am jeweils abzumarkenden Grenzpunkt der beantragten anliegenden Grenze des Antragsgrundstücks gebührentechnisch zu berücksichtigen.
Eine Abmarkung in nur einem Grenzpunkt auf dem Antragsgrundstück ist kein Sonderfall. Auch hier ist die Länge einer beantragten anliegenden Grenze abzurechnen. Dabei ist gebührentechnisch für die Gebühr die anrechenbare Länge von mindestens 15 m und maximal 75 m zu berücksichtigen. Werden beide Grenzpunkte der wiederhergestellten Grundstücksgrenze abgemarkt, ist die Länge der Grenze maximal auf 500 m begrenzt. Die Abrechnung einer Mindestgrenzlänge ist hier nicht zu erheben.
Können alle abrechnungsrelevanten Parameter einem Grundstück zugeordnet werden (z. B. Abmarkung einer bestehenden Grenze), ist grundsätzlich der Sockelbetrag nur für ein Grundstück abzurechnen.
Sonderung
Die Sonderung ist die Zerlegung eines Flurstücks ohne örtliche Vermessung.
Örtliche Vermessungen, die im Vorfeld oder im Nachhinein durchgeführt werden, sind immer nach der Tarifstelle 4.2 oder den Tarifstellen 4.3 bis 4.5 abzurechnen. Eine kombinierte Liegenschaftsvermessung nach den Tarifstellen 4.2 bis 4.5 mit einer Sonderung ist nicht zulässig. Zu den Voraussetzungen einer Sonderung siehe VVLiegVerm, Nr. 7.
Die Allgemeine Regelung Nr. 2 bezieht sich nach wörtlicher, historischer und teleologischer Auslegung nur auf die Sonderung für Liegenschaftsvermessungen nach Tarifstelle 4.6.2.
Die maximale Länge der neuen Grenze für die Abrechnung ist auf 150 m begrenzt.
Für Infrastrukturnlagen erfolgt die Abrechnung der Sonderung gemäß Tst. 4.6.1 unter Berücksichtigung der Allgemeinen Regelungen der Tarifstelle 4.2.
Die Rückführung verschmolzener Flurstücke im Zusammenhang mit der Regelung offener Vermögensfragen erfüllt nicht die Voraussetzungen für eine Sonderung im Sinne der VVLiegVerm. Die Regelleistungen einer Sonderung fallen nicht an. Wiederhergestellt wird der Katasterzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Alle damit verbundenen Tätigkeiten sind nach Zeit (§ 6) abzurechnen.
| 4.7 | Passpunktbestimmung, je Punkt | 250 |
Passpunktbestimmung
| 4.8 | Bodenordnungsverfahren | Zeitgebühr |
Bodenordnungsverfahren
Bodenordnungsverfahren im Sinne der VermGebO sind Verfahren, denen für den verfahrensrechtlichen und teilweise auch verfahrenstechnischen Teil Spezialgesetze (BauGB, BoSoG, BbgLEG, etc.) zugrunde liegen. Sie dienen unterschiedlichen Zielen wie der Neuordnung der Eigentumsverhältnisse, der Bereinigung der Rechtsverhältnisse, der Schaffung der Realkreditfähigkeit der Grundstücke.
Die Vermessung der Grenzen des Umrings eines Bodenordnungsverfahrens ist Bestandteil des Verfahrens und ist nach dem Zeitaufwand abzurechnen.
Die Tarifstelle umfasst die Vermessungstätigkeiten, nicht die Tätigkeit der Bodenordnungsbehörde bei der Durchführung des Bodenordnungsverfahrens.
Vermessungen im Altbestand sind Liegenschaftsvermessungen, die zwar nur mit der Genehmigung der Bodenordnungsbehörde ausgeführt werden dürfen, aber in der Zuständigkeit der Katasterbehörde in das Liegenschaftskataster übernommen werden. Die vermessungstechnische Abrechnung erfolgt nach den Tarifstellen 4.1 bis 4.6 bzw. nach Tarifstelle 5.
Amtlicher Lageplan
Die Regelleistungen für die Erstellung des amtlichen Lageplans sind aus der Bauvorlagenverordnung zu entnehmen. Nach § 3 Abs. 2 BbgBauVorlV enthält der amtliche Lageplan Tatbestände an Grund und Boden, die durch vermessungstechnische Ermittlungen einer Katasterbehörde oder eines Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs festgestellt worden sind oder auf solche Ermittlungen zurückgehen und die mit öffentlichem Glauben beurkundet sind.
Die Bauaufsichtsbehörde soll nach § 1 Abs. 4 BbgBauVorlV auf Bauvorlagen verzichten, wenn diese zur Beurteilung des einzelnen Bauvorhabens nicht erforderlich sind. In diesem Fall ist kein Amtlicher Lageplan zu fertigen, die Leistung ist nicht nach der VermGebO abzurechnen und notwendige Vermessungsunterlagen sind nicht nach der Tarifstelle 2.2, sondern nach den Tarifstellen 2.3 abzurechnen.
Das Baufeld ist in der Tarifstelle 5.1 Nr. 2 definiert. Es ist die Abrechnungseinheit und umfasst die bebaubare Fläche eines oder mehrerer Grundstücke; bei großen Baufeldern (über 1.000 m²) ist das Baufeld auf die baurechtlichen Belange zu begrenzen.
Baufeld bei Windenergieanlagen (WEA)
Das Baurecht des Landes Brandenburg muss auch bei Bauvorhaben auf der Grundlage des Bundesimmissionsschutzgesetzes eingehalten werden. Demzufolge sind auch hierfür grundsätzlich Amtliche Lagepläne nach § 3 Abs. 2 BauVorlV zu fertigen. Hier sind alle Leistungen, die in der BauVorlV insbesondere für die Darstellung der Grundstücksgrenzen und Gebäude definiert sind, einzuhalten. Bei Windenergieanlagen ergibt sich die darzustellende Fläche aus den für die Beurteilung des Bauvorhabens zwingend darzustellenden Sachverhalten.
Die Gebühr ist für jedes Baufeld einzeln zu erheben. Bei Amtlichen Lageplänen für Windenergieanlagen ist für jede Anlage ein eigenes Baufeld abzurechnen. Die mindestens darzustellende Fläche des Baufeldes wird im Allgemeinen durch die Fläche der Darstellung der Höhenlage des engeren Baufeldes (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 BbgBauVorlV) begrenzt. Andere baurechtliche Belange, wie Abstandsfläche gemäß Brandenburgischer Bauordnung (bei Windenergieanlagen gemäß Nr. 6.9.1.4 der Verwaltungsvorschrift zur Brandenburgischen Bauordnung in Verbindung mit Anlage 1 VVBbgBO die Kreisfläche der fiktiven Außenwand) oder die Flächen, für die zwingend darzustellenden Infrastrukturen, die das Projekt erschließen und darüber hinaus dargestellt werden müssen, erweitern das Baufeld. Verbindungswege zwischen den Anlagen vereinigen nicht die Baufelder. Die Wegeflächen selbst, soweit sie kein eigenes Baufeld bilden, werden einem Baufeld ganz oder in Teilflächen mehreren Baufeldern zugeschrieben.
| 5.1.1 | Gebühr für die Erstellung eines amtlichen Lageplans bis zu einer Baufeldgröße von 1 000 m² | 900 |
Amtlicher Lageplan (Standard)
Im Einzelnen ist der amtliche Lageplan auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters anzufertigen. Er muss nach § 3 Abs. 2 BbgBauVorlV folgende Angaben enthalten:
- Lage des Grundstücks zur Nordrichtung,
- im Grundbuch geführte Bezeichnung des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke mit den jeweiligen Eigentümerangaben,
- katastermäßige Flächengrößen und Flurstücksnummern und die Flurstücksgrenzen des Baugrundstücks und der benachbarten Grundstücke,
- Höhenlage der Grenzpunkte des Baugrundstücks oder bei größeren Grundstücken die Höhenlage des engeren Baufeldes,
- angrenzende öffentliche Verkehrsflächen mit Angabe der Breite, der Straßengruppe und der Höhenlage,
- Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer Satzung für das Baugrundstück über Art und Maß der baulichen Nutzung sowie die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen,
- Flächen auf dem Baugrundstück, die von Dienstbarkeiten oder Baulasten betroffen sind,
- durch Rechtsverordnung oder Satzung geschützte Landschaftsbestandteile sowie Wald auf dem Baugrundstück,
- vorhandene bauliche Anlagen auf dem Baugrundstück und deren Abstandsflächen sowie die für die Beurteilung des Vorhabens bedeutsamen vorhandenen baulichen Anlagen auf den Nachbargrundstücken und deren Abstandsflächen.
Nicht in der Gebühr enthalten sind die Erfassung und Dokumentation der geplanten baulichen Anlagen und weitere Angaben aus dem objektbezogenen Lageplan nach § 4 BauVorlV, die als nachrichtliche Eintragungen aufgenommen werden können. Sie sind nicht mit den Tarifstellen der Vermessungsgebührenordnung abzurechnen. Diese Tätigkeiten sind privatrechtlicher Natur.
| 5.1.2 | Gebühr für die Erstellung eines amtlichen Lageplans | |
| - bei zuverlässig nachgewiesenen Grundstücksgrenzen und baulichen Anlagen gemäß § 3 Absatz 4 BbgBauVorlV oder | ||
| - im Außenbereich (§ 35 BauGB), wenn keine vorhandenen baulichen Anlagen darzustellen oder diese bereits im Liegenschaftskataster qualitätsgerecht nachgewiesen sind, | ||
| bis zu einer Baufeldgröße von 1 000 m² | 700 |
Amtlicher Lageplan (Sonderfall)
Diese Tarifstelle gilt dann, wenn aufgrund des qualitätsgerechten Nachweises für die Grundstücksgrenzen und die baulichen Anlagen die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für die Erstellung des Amtlichen Lageplans geeignet sind. Dies ist dann der Fall, wenn die für die Beurteilung des Vorhabens maßgeblichen Grundstücksgrenzen und baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück und den benachbarten Grundstücken im Liegenschaftskataster zuverlässig nachgewiesen sind. Für Projekte im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist diese Tarifstelle anzuwenden, wenn die darzustellenden bestehenden baulichen Anlagen bereits im Liegenschaftskataster qualitätsgerecht nachgewiesen sind. Die Voraussetzungen der Anwendung dieser Tarifstelle liegen nicht mehr vor, wenn für das Gebiet Planungsrecht gilt und die Grenzen und baulichen Anlagen nicht qualitätsgerecht im Liegenschaftskataster vorliegen. Der amtliche Lageplan ist dann nach Tarifstelle 5.1.1 abzurechnen.
Grundstücksgrenzen sind im Liegenschaftskataster in der Regel dann zuverlässig nachgewiesen, wenn die Grenzen festgestellt sind oder als festgestellt gelten und ihre Grenzpunkte mit der erforderlichen Genauigkeit im geodätischen Bezugssystem des amtlichen Vermessungswesens vorliegen. Das bedeutet, dass alle Grenzpunkte der darzustellenden Grenzen sowie die baulichen Anlagen die Qualitätsanforderungen an die Lagebestimmung der Liegenschaften (VVLiegVerm Anlage 4) und Lagezuverlässigkeit - Punktidentität festgestellt - (Punktnachweisrichtlinien Nr. 3.2.6) erfüllen.
Die Darstellung der baulichen Anlage als Topographie entspricht nicht der notwendigen Qualitätsanforderung.
Wird der amtliche Lageplan im zeitlichen Zusammenhang mit einer Liegenschaftsvermessung nach Tst. 4.3 auf demselben Grundstück erstellt und ist wegen der zeitlichen Nähe die ermittelte beziehungsweise bereits festgestellte Grenze noch nicht im Liegenschaftskataster dargestellt, ist die Tarifstelle 5.1.2 anzuwenden, wenn deren weiteren Voraussetzungen vorliegen.
Wenn auch nur eine der für die bauaufsichtsrechtliche Beurteilung erheblichen Grundstücksgrenzen oder eine bauliche Anlage im Liegenschaftskataster nicht zuverlässig nachgewiesen ist, also eine örtliche Messung erforderlich wird, muss der amtliche Lageplan nach Tst. 5.1.1 abgerechnet werden.
| 5.1.3 | Gebühr für die Erstellung eines amtlichen Lageplans für untergeordnete Wohnanbauten oder untergeordnete Wohnnebengebäude. Die Bruttogrundfläche darf 50 m² nicht überschreiten | 500 |
Amtlicher Lageplan (Wohnnebengebäude etc.)
Dieser amtliche Lageplan kann nur für kleine Bauprojekte abgerechnet werden. Das Kriterium für die Anwendung dieser Tarifstelle ist einerseits die Unterordnung des geplanten Bauwerks zum Hauptwohngebäude und andererseits die maximale Größe des geplanten Bauwerks von 50 m² Bruttogeschossfläche. Nur wenn beide Kriterien erfüllt sind, ist diese Tarifstelle anzuwenden. Die zwingend darzustellende Fläche darf in diesen Fällen nicht über die durch den Anbau bedingten Flächen hinausgehen. Sind darüber hinaus weitere Tatbestände an Grund und Boden darzustellen, die aufgrund der besonderen Lage des Grundstücks, aufgrund des Hauptbauwerkes oder aufgrund anderer Vorgaben der Bauaufsicht notwendig werden, ist ein amtlicher Lageplan nach Tarifstelle 5.1.1 bzw. Tarifstelle 5.1.2 abzurechnen.
| 5.1.4 | Gebühr für die Erstellung eines amtlichen Lageplans auf der Grundlage eines von der Vermessungsstelle für dasselbe Erfassungsgebiet früher erstellten amtlichen Lageplans, sofern der früher erstellte Lageplan nicht älter als 6 Jahre ist, bis zu einer Baufeldgröße von 1 000 m² | 500 |
Amtlicher Lageplan („Aktualisierte Neuausfertigung“)
Die Tarifstelle kann nur für eine aktualisierte Neuausfertigung eines Amtlichen Lageplans für dasselbe Erfassungsgebiet oder eine Teilfläche dessen angewandt werden, wenn die erstmalige Ausfertigung des Amtlichen Lageplans nicht älter als 6 Jahre ist.
| 5.1.5 | über 1 000 m² bis 2 000 m², zuzüglich der Gebühr nach Tarifstelle 5.1.1 oder 5.1.2 oder 5.1.4 - je weitere angefangene 100 m² | Flächengebühr |
| 5.1.6 | über 2 000 m² bis 5 000 m², zuzüglich der Gebühr nach Tarifstelle 5.1.5 - je weitere angefangene 300 m² | Flächengebühr |
| 5.1.7 | über 5 000 m² bis 10 000 m², zuzüglich der Gebühr nach Tarifstelle 5.1.6 - je weitere angefangene 500 m² | Flächengebühr |
| 5.1.8 | über 10 000 m² bis 100 000 m², zuzüglich der Gebühr nach Tarifstelle 5.1.7 - je weitere angefangene 900 m² | Flächengebühr |
| 5.1.9 | über 100 000 m², zuzüglich der Gebühr nach Tarifstelle 5.1.8 - je weitere angefangene 5 000 m² | Flächengebühr |
Flächengebühr
Die Gebühren der Tarifstellen 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.4 sind Grundgebühren, auf die eine flächenabhängige Gebühr zu addieren ist, wenn die Fläche des Baufeldes 1 000 m² überschreitet. Diese Gebühr berechnet sich flächenabhängig in Stufen von Tarifstelle 5.1.5 bis Tarifstelle 5.1.9, wobei bis zum Erreichen der Gesamtfläche jede einzelne Stufe in die Berechnung einfließt.
Beispiel:
amtlicher Lageplan mit Grenzuntersuchung, Baufeldgröße 11 100 m²
Tst. 5.1.1 = 900 €
zuzüglich Tst. 5.1.5 (10 Einheiten á 9 %) = 810 €
1000 m² bis 2000 m² = 1000 /100 = 10 x 900 x 9 %
zuzüglich Tst. 5.1.6 (10 Einheiten á 9 %) = 810 €
2000 m² bis 5000 m² = 3000 /300 = 10 x 900 x 9 %
zuzüglich Tst. 5.1.7 (10 Einheiten á 9 %) = 810 €
5000 m² bis 10000 m² = 5000 /500 = 10 x 900 x 9 %
zuzüglich Tst. 5.1.8 ( 2 Einheiten á 9 %) = 162 €
10000 m² bis 11100 m² = 1100 /900 = 2 x 900 x 9 %
Gebühr = 3 492 €
Grundflächen- und Höhennachweis
Die Tarifstelle 5.2 ist nur in Verbindung mit der Tarifstelle 4.1 (Einmessung baulicher Anlagen) anzuwenden. Die Gebäudeeinmessung muss gleichzeitig erbracht werden. Für eine einzelne separate Einmessungsbescheinigung ist die VermGebO nicht anzuwenden.
Mehrausfertigungen
Die unbestimmte (Mehr-)Anzahl der Ausfertigungen (insbesondere des Grenzzeugnisses, des Amtlichen Lageplans) übersteigt den Standard der ersten Ausfertigung. Für die zu fertigende Anzahl der Auszüge ist der Antrag maßgebend.
Bei mehreren Berechtigten ist für jeden Berechtigten eine Erstausfertigung des Unschädlichkeitszeugnisses in der Gebühr der Tst. 3 enthalten. Jede weitere Ausfertigung ist nach Tarifstelle 6.3 abzurechnen.
Jeder Beteiligte an der Fortführung erhält eine Erstausfertigung der Benachrichtigung für seine Fortführungsnummer, die mit der Gebühr nach Tarifstelle 7 abgegolten ist. Jede weitere Benachrichtigung über die Fortführung des Liegenschaftskatasters zu einer Fortführungsfallnummer ist eine Mehrausfertigung.
Unter diese Tarifstelle fällt nicht nur die Übernahme von Geobasisdaten, die im Ergebnis einer Liegenschaftsvermessung entstanden sind (Vermessungsschriften), sondern jede antragsbezogene Fortführung oder Berichtigung des Liegenschaftskatasters.
Übernahme von Infrastrukturanlagen

Der Bodenrichtwert (siehe auch § 5 VermGebO) dient als Grundlage für die Ermittlung der Bodenwertstufe bei der Übernahme. Er kann jedoch nur herangezogen werden, wenn der Bodenrichtwert geeignet ist, d.h. wenn die Merkmale des Richtwertgrundstücks mit den Merkmalen des Flurstücks hinreichend übereinstimmen. Bei einem Flurstück einer Verkehrsanlage (zum Beispiel Straße) ist dieses nicht der Fall, da der Bodenrichtwert für Bauland nicht für Straßenland gelten kann. Straßenland ist als bleibende Gemeinbedarfsfläche im Allgemeinen dem Grundstücksmarkt entzogen und ist daher nur mit einem “Anerkennungswert“ anzusetzen. Insofern ist bei der Übernahmegebühr für das Flurstück der Verkehrsanlage ein Bodenwert von unter 3,- € für Straßenland anzusetzen. Für das Restflurstück gilt zwar ein Bodenwert von 70,- € für Bauland, aber im Zuge der Übernahme einer Infrastrukturanlage ist auch hier der gleiche Bodenwert (unter 3 €) für das Restflurstück anzusetzen.
Eine flächengewichtete Ermittlung anhand verschiedener Bodenrichtwerte ist hier nicht richtig, da jedem Flurstück ein eigenständiger Bodenwert zugeordnet werden kann. Die flächengewichtete Ermittlung des Bodenwertes aus Bodenrichtwerten kommt dann in Frage, wenn ein Flurstück in mehreren Bodenrichtwertzonen liegt und die betroffenen Bodenrichtwerte auch für die Bodenwertermittlung herangezogen werden können, d.h. wenn die Merkmale des Flurstücks mit den Merkmalen der betroffenen Bodenrichtwertgrundstücke hinreichend übereinstimmen.
Bei anderen Infrastrukturanlagen (zum Beispiel eine Hochspannungsleitung) kann der Bodenrichtwert im Allgemeinen angehalten werden, da die Nutzung des Grundstücks uneingeschränkt weiter ausgeübt werden kann.
Bei der Festsetzung der Übernahmegebühren für Infrastrukturanlagen sind die Prozentsätze für die Kategorien, wie sie bei der Tarifstelle 4.2 festgesetzt werden, auch bei dieser Tarifstelle zu berücksichtigen. Für die Übernahmegebühr ist der gleiche Prozentsatz der Infrastrukturanlage aus der Einstufung nach Tarifstelle 4.2 zu verwenden. Werden von einem Flurstück mehrere Teilflächen einer Infrastrukturanlage verschiedener Kategorien abgetrennt, ist für diesen Teil des alten Flurstücks, der nicht in die Infrastrukturanlage einbezogen wird (Restflurstück), die höhere Kategorie, die an das alte Flurstück angrenzt, bei der Übernahmegebühr zu berücksichtigen.
Gebäudeeinmessung
Die Berechnung der Gebühr für die Übernahme von baulichen Anlagen entspricht der Vorgehensweise nach Tarifstelle 4.1. Auch hier sind der Wert des Eigenheimes und der Wert der gleichzeitig eingemessenen Nebengebäude als Gesamtwert der Gebührenberechnung zu Grunde zu legen.
Grundstück
Können alle abrechnungsrelevanten Parameter einem Grundstück zugeordnet werden (z. B. Abmarkung einer bestehenden Grenze), ist grundsätzlich nur ein Grundstück abzurechnen.
Bei einem Abmarkungsverfahren oder einem Verfahren, bei dem eine gemeinsame Grenze zweier Grundstücke betroffen ist, ist nur eines der anliegenden Grundstücke (nur das Grundstück des Antragstellers) für die Gebührenberechnung anzuhalten.
Benachrichtigungen
Die Pflichtbenachrichtigungen über die Fortführung des Liegenschaftskatasters (ALKIS-Richtlinien, Personen- und Bestandsdaten, Nr. 5.1) sind mit der Gebühr abgegolten und werden den Adressaten kostenfrei übersandt. Neben dem Eigentümer und Erbbauberechtigten, Grundbuch- und Finanzamt erhält auch der Antragsteller der Liegenschaftsvermessung eine Benachrichtigung kostenfrei, wenn er nicht bereits eine Ausfertigung als Eigentümer oder Erbbauberechtigter erhalten hat.
Eine Gebühr entsteht auch, wenn ein Antrag negativ beschieden wird.
| 9 | Rechtsbehelfe | |
| Zurückweisung oder Teilzurückweisung von Drittwidersprüchen | 10 bis 500 |
Das Gebührengesetz regelt die Gebühr bei der Rücknahme bzw. Ablehnung des Antrags (§ 17 GebGBbg) sowie die Gebühren im Widerspruchsverfahren (§ 18 GebGBbg). In der Gebührenordnung ist nur eine Gebühr für Widersprüche Dritter zu regeln.
Anlage zur AVGebühren
Es bestehen bundesrechtliche Kostenregelungen, die den landesrechtlichen Regelungen vorgehen und den in Betracht kommenden landesrechtlichen Gebührentarif ganz oder teilweise außer Kraft setzen. Zum Teil bleibt das Landesrecht von den bundesrechtlichen Kostenregelungen aber ausdrücklich unberührt. Zudem gibt es spezielle landesrechtliche Kostenbefreiungen. Auch künftig ist mit solchen kostenbefreienden Regelungen zu rechnen. Darauf haben die Behörden aus eigenem Antrieb zu achten, denn es kann nicht sichergestellt werden, alle maßgeblichen Sonderregelungen hier zu erfassen bzw. eine geänderte Rechtslage rechtzeitig in diese Hinweise aufzunehmen.
Zur Arbeitserleichterung werden bekannte Sonderregelungen aufgeführt.
BUNDESRECHT
11.08.1919 Landwirtschaftliche Siedlung
14.07.1953 Flurbereinigungsgesetz
25.07.1957 Stiftung "Preußischer Kulturbesitz"
23.06.1960 Baugesetzbuch
hier: Umlegung / Grenzregelung - keine Gebührenbefreiung
01.07.1965 Gräbergesetz
28.07.1969 Bundesknappschaft-Errichtungsgesetz
18.08.1980 Sozialgesetzbuch
29.06.1990 Landwirtschaftsanpassungsgesetz
21.09.1994 Sachenrechtsbereinigungsgesetz
02.12.1994 Vermögensgesetz - keine Gebührenbefreiung
Landesrechtliche Regelungen
Landwirtschaftliche Siedlung
Rechtsgrundlage
- Reichssiedlungsgesetz vom 11.08.1919 (RGBl. S.1429 - Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2331-1), Neubekanntmachung vom 01.01.1964 (BGBl. III 24), zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2355, 2386)
- Gesetz zur Ergänzung des Reichssiedlungsgesetzes vom 04.01.1935 (RGBl. I S. 1), in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2331-2, zuletzt geändert durch § 28 GrundstücksverkehrsG vom 28.07.1961 (BGBl. I S. 1091).
Zuständigkeiten
- Gemäß § 1 der Verordnung zur Durchführung des Reichssiedlungsgesetzes (RSGDV) vom 29.07.1998 (GVBl. II S. 514) sind Siedlungsbehörden im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 2 und des § 12 des Grundstücksverkehrsgesetzes sowie des § 4 Abs. 5 und des § 6 Abs. 1 des Reichssiedlungsgesetzes die Ämter für Flurneuordnung und ländliche Entwicklung.
- Nach § 2 RSGDV ist Siedlungsunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 des Reichssiedlungsgesetzes die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.
Gebührenregelung
§ 29 des Reichssiedlungsgesetzes:
(1) Alle Geschäfte und Verhandlungen, die zur Durchführung von Siedlungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes dienen, sind, soweit sie nicht im Wege des ordentlichen Rechtsstreits vorgenommen werden, von allen Gebühren, ...(Auslassungen gegenstandslos) und Steuern des Reichs, der Bundesstaaten und sonstigen öffentlichen Körperschaften befreit. Die Befreiung erstreckt sich insbesondere auch auf Umsatz- und Wertzuwachssteuern jeder Art, auf letztere insbesondere auch dann, wenn sie von dem Erwerber von Land oder Inventar durch das gemeinnützige Siedlungsunternehmen erhoben werden.
(2) Die Gebühren-,... und Steuerfreiheit ist durch die zuständigen Behörden ohne weitere Nachprüfung zuzugestehen, wenn das gemeinnützige Siedlungsunternehmen (§ 1) versichert, dass ein Siedlungsverfahren im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes vorliegt und dass der Antrag oder die Handlung zur Durchführung eines solchen Verfahrens erfolgt. Die Versicherung unterliegt nicht der Nachprüfung durch die Finanzbehörden.
§ 8 - Gesetz zur Ergänzung des Reichssiedlungsgesetzes
Die Gebühren-... und Steuerfreiheit nach § 29 des Reichssiedlungsgesetzes gilt auch für die Fälle, in denen ein Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung für Siedlungszwecke erworben wird.
Gesetzeserläuterungen
- Durch § 29 wird die Siedlung von allen Verfahrenssteuern des Reichs und der Länder und von öffentlichen Gebühren befreit. In Betracht kommen insbesondere die Grunderwerbssteuer, ferner die bei dem Siedlungsverfahren entstehenden Gebühren. Die ausdrücklich erwähnte Umsatzsteuerbefreiung wurde im Hinblick auf das Defizit des Bundeshaushalts im Jahre 1966 durch das Zweite Finanzplanungsgesetz (Steueränderungsgesetz 1966) vom 23.12.1966 (BGBl. I S. 702), Artikel 5 aufgehoben. Die Stempelsteuer wird nicht mehr erhoben, nachdem diese Steuer durch § 51 des Urkundensteuergesetztes vom 05.05.1936 aufgehoben worden ist. Begünstigt sind nur Geschäfte und Verhandlungen, die zur Durchführung eines Siedlungsverfahrens dienen, soweit sie nicht im Wege des ordentlichen Rechtsstreits vorgenommen werden.
- Nach der Rechtsprechung des RFH und BFH wird die Steuerfreiheit nur für unmittelbar der Siedlung dienende Geschäfte und Verhandlungen gewährt. Nach dem auch heute noch grundsätzlich gültigen Runderlass des ehemaligen Reichsfinanzministers vom 11.12.1940 (Reichssteuerbl. S. 1026) dient nicht unmittelbar der Siedlung, was nicht der Durchführung eines bestimmten Siedlungsverfahrens dient. § 29 ist nach diesem Runderlass deshalb auf solche Vorgänge nicht anwendbar, die nicht der Durchführung eines bestimmten Siedlungsverfahrens dienen. Ob diese einschränkende Auslegung der heutigen Bedeutung der Siedlung insbesondere der Bedeutung der Agrarstrukturverbesserung, die der Siedlung gleichgestellt ist, entspricht, mag zweifelhaft sein. Nach dem Runderlass sollen insbesondere steuerpflichtig sein, die Errichtung der Siedlungsgesellschaften, die Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der Siedlungsgesellschaft, die allgemeine Finanzierung des Siedlungsunternehmens, der Empfang von Betriebsmittelkrediten, soweit diese nicht zur Durchführung eines bestimmten Verfahrens als Ersatz für Eigenmittel der Gesellschaft gegeben werden, Miet- oder Kaufverträge über Geschäftsräume oder Geschäftsgrundstücke für das Siedlungsunternehmen, Dienstverträge mit Angestellten, Beschaffung der Geschäftsbedürfnisse für das Siedlungsunternehmen, Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken für das Siedlungsunternehmen außerhalb eines bestimmten Verfahrens, z.B. Übernahme eines Grundstücks zum Ausgleich erhobener Schadensersatzansprüche. Dagegen dienen die Geschäfte und Verhandlungen nach dem Runderlass unmittelbar der Siedlung und fallen deshalb unter die Befreiungsvorschrift des § 29 insbesondere die Finanzierung des einzelnen Siedlungsvorhabens und der Erwerb des für Siedlungszwecke bestimmten Landes durch das Siedlungsunternehmen. Diese Befreiung gilt auch für Grundstücksteile und Wirtschaftsgüter, die nicht für die Siedlung oder die Siedler Verwendung finden können, aber beim Erwerb einer wirtschaftlichen Einheit zwangsläufig mit erworben werden müssten. Begünstigt ist fernerhin der Aufbau der einzelnen Siedlerstelle einschließlich der Baustoffbeschaffung durch das Siedlungsunternehmen, ferner die Einrichtung der Siedlerstelle und die Beschaffung des Inventars durch das Siedlungsunternehmen, die Finanzierungsmaßnahmen für die Ansetzung der einzelnen Siedler und die Abgabe der Siedlerstellen an die einzelnen Siedler (Pachtvertrag, Kaufvertrag, Rentengutsvertrag, Übereignungsvertrag usw.), die Abgabe von Land an Anliegersiedler usw. Auch Gemeinschaftsanlagen und Einrichtungen, die der Gesamtheit der Siedler dienen, können steuerfrei geschaffen werden. Hierzu gehört u.a. die Beschaffung des Landes für solche Gemeinschaftsanlagen, z. B. für die Schule, Kirche usw., ferner die Beschaffung von Maschinen für eine genossenschaftliche Brennerei usw. § 29 findet auch Anwendung auf die durch die Zwischenbewirtschaftung des für die Siedlung erworbenen Landes erforderlichen Geschäfte und Verhandlungen. Nicht begünstigt soll dagegen nach dem genannten Runderlass der Erwerb von Land sein, das für Siedlungsland in Tausch gegeben werden soll, ferner die Hingabe des Tauschlandes durch das Siedlungsunternehmen (vgl. hierzu besonders auch zu der Frage, inwieweit durch das GrdstVG und durch die Gleichstellung der Siedler mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur nicht auch eine Ausweitung des § 29 RSG erfolgt ist - Ehrenforth Kom. RSG § 29 Anm. 3 a).
- Von der Grunderwerbssteuer sind die unter 2) genannten Geschäfte und Verhandlungen befreit, soweit sie unmittelbar der Siedlung, d. h. dem Siedlungsverfahren dienen. Das gilt auch für die Maßnahmen, die von den Ländern nach § 26 RSG und nach den Ausführungsbestimmungen des Reichsarbeitsministers vom 26.09.1919 zur Siedlung erklärt worden sind oder noch erklärt werden. Die Grunderwerbssteuer unterliegt zwar nach Artikel 105 Abs. 2 Nr. 1 GG der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder. § 29 RSG ist aber vorkonstitutionelles Bundesrecht und gilt daher als Landesrecht weiter, sofern es nicht hinsichtlich der Grunderwerbssteuer durch späteres Landesrecht ausdrücklich geändert worden ist oder geändert wird.
- Die Befreiung der Geschäfte und Verhandlungen, die der Siedlung dienen, von der Umsatzsteuer gemäß § 29 RSG war durch § 49 der Durchführungsbestimmungen zum UStG vom 08.09.1961 (hier abgedruckt unter VII B 31 a) geregelt. Gemäß Artikel 5 Buchst. a des Steueränderungsgesetzes 1966 vom 23.12.1966 wurde die Umsatzsteuerbefreiung des § 29 RSG aufgehoben (s. Erläut. 1); entsprechend wurde durch Artikel 6 Nr. 1 des Steueränderungsgesetzes 1966 § 49 der Durchführungsbestimmungen zum UstG aufgehoben.
- Die Gebührenbefreiung erstreckt sich auf alle Gebühren des Bundes und der Länder und der Körperschaften des öffentlichen Rechts, die für die Durchführung der dem Siedlungsverfahren dienenden Geschäfte und Verhandlungen erhoben werden. In Frage kommen vor allem Gebühren für die Beurkundung von Verträgen, von Eintragungs- und Löschungsbewilligungen, für Grundbuch- und Registereintragungen, für die Eintragung eines gemeinnützigen Siedlungsunternehmens in das Handelsregister, für die Erteilung von Auszügen aus dem Grundbuch, für Beglaubigungen von Unterschriften usw., ferner die Baugebühren für die Prüfung von Bauunterlagen und für die Bauabnahme, Vermessungsgebühren, Katastergebühren usw.
Flurbereinigungsgesetz
Rechtsgrundlage
- Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 14.07.1953 (BGBl. I S. 591) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) (BGBl. III 7815-1), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794, 2835).
- Gesetz über die ländliche Entwicklung und zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes im Land Brandenburg (Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz- BbgLEG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 14, S. 298) geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl. I/10, Nr. 28)
Zuständigkeit
- Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Gebührenregelung
§ 108 FlurbG
(1) Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung der Flurbereinigung dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Gebühren, Steuern, Kosten und Abgaben; hiervon unberührt bleiben Regelungen hinsichtlich der Gebühren, Kosten und Abgaben, die auf landesrechtlichen Vorschriften beruhen.
(2) Die Gebühren-, Steuer-, Kosten- und Abgabefreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die Flurbereinigungsbehörde versichert, dass ein Geschäft oder eine Verhandlung der Durchführung der Flurbereinigung dient.
§ 13 BbgLEG
(1) Geschäfte und Verhandlungen, die dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Steuern, Gebühren, Kosten und Abgaben, die auf landesrechtlichen Vorschriften beruhen.
(2) Die Steuer-, Gebühren-, Kosten- und Abgabenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die obere Flurbereinigungsbehörde versichert, dass ein Geschäft oder eine Verhandlung dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes oder des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes dient.
Erläuterung
Die Gebührenbefreiung nach § 108 FlurbG gilt auf Grund der landesrechtlichen Vorschrift des § 13 BbgLEG für alle Amtshandlungen der Kataster- und Vermessungsbehörden.
Stiftung "Preußischer Kulturbesitz"
Rechtsgrundlage
Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Preußischer Kulturbesitz" und zur Übertragung von Vermögenswerten des ehemaligen Landes Preußen auf die Stiftung vom 25.07.1957 (BGBl. I S. 841) (BGBl. III 224-3), zuletzt geändert durch Artikel 15 Absatz 59 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160).
Zuständigkeit
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Gebührenregelung
Nach § 24 des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung "Preußischer Kulturbesitz" werden Gerichtsgebühren und andere Abgaben, die aus Anlass und in Durchführung dieses Gesetzes entstehen, nicht erhoben. Bare Auslagen bleiben außer Ansatz.
Baugesetzbuch
hier: Umlegung/Grenzregelung
Rechtsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.06.1960 (BGBl. I S. 341) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) (BGBl. III 213-1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)
Zuständigkeiten
- Gemeinde - § 46 Abs. 1 (Umlegung) und § 80 Abs. 1 (Grenzregelung) BauGB
- Flurbereinigungsbehörde oder eine andere geeignete Behörde - § 46 Abs. 4 (Umlegung) und § 80 Abs. 3 (Grenzregelung) BauGB
Gebührenregelung
Nach § 79 BauGB sind Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung oder Vermeidung der Umlegung dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, frei von Gebühren und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von Auslagen; dies gilt nicht für die Kosten eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben Regelungen nach landesrechtlichen Vorschriften.
Die Abgabenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die Umlegungsstelle versichert, dass ein Geschäft oder eine Verhandlung der Durchführung oder Vermeidung der Umlegung dient.
Nach § 84 Abs. 2 BauGB gilt die Gebührenregelung des § 79 BauGB auch für die Grenzregelung.
Erläuterung
Die landesrechtlichen Vorschriften heben die Gebührenbefreiung auf. Nach der VermGebO, Tst. 4.8 ist für die Vermessungstätigkeit eine Zeitgebühr, für die Übernahme der Ergebnisse der Umlegung bzw. Grenzregelung nach Tst. 7.2 für jedes neu entstehende Flurstück bzw. Tst. 7.3 die ausgewiesene Gebühr zu erheben.
Gräbergesetz
Rechtsgrundlage
Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz - GräbG) vom 01.07.1965 (BGBl. I S. 598) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.01.2012 (BGBl. I S. 98 - BGBl. III S. 2184-1), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. I. S. 2586)
Zuständigkeit
Gemäß § 12 Gräbergesetz werden Aufgaben nach diesem Gesetz, soweit nichts anderes bestimmt ist, von den nach Landesrecht bisher zuständigen oder den von der Landesregierung bestimmten Stellen wahrgenommen.
Das Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg) vom 23. Mai 2005 (GVBl. I S. 174), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 206) nennt als zuständige Stellen
- die kreisfreien Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden (§ 5 Abs. 1),
- die Landräte sowie die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte (§ 5 Abs. 2),
- das Ministerium des Innern (§ 5 Abs. 3).
Die Zuständigkeitsbereiche sind im Einzelnen festgelegt.
Gebührenregelung
§ 11 Gräbergesetz - Befreiung von Gebühren, Auslagen und Steuern:
(1) Für Amtshandlungen, die bei Durchführung dieses Gesetzes mit Ausnahme des § 7 erforderlich werden, werden Gebühren und Auslagen nicht erhoben. Dies gilt auch für Gerichtskosten, Beurkundungs- und Beglaubigungskosten nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz.
(2) Die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz gilt nicht als gewerbliche Tätigkeit im Sinne des § 2 Absatz 3 des Umsatzsteuergesetzes.
Bundesknappschaft-Errichtungsgesetz
Rechtsgrundlage
Gesetz zur Errichtung der Bundesknappschaft (Bundesknappschaft-Errichtungsgesetz - BKnEG) vom 28.07.1969 (BGBl. I S. 974 - BGBl. III 822-12), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 91 des Gesetzes vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160).
Zuständigkeit
Bundesknappschaft (Artikel 4 § 2 Abs. 1 BknEG)
Gebührenregelung
Artikel 4, § 7 Abs. 1 und Abs. 2 des BknEG
Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung der §§ 2 bis 6 dieses Artikels dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Gebühren, Steuern und Auslagen; dies gilt auch für Beurkundungs- und Beglaubigungsgebühren, nicht aber für die Kosten eines Rechtsstreits.
Die Gebühren-, Steuer- und Auslagenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die Bundesknappschaft bestätigt, dass die Maßnahme der Durchführung der § 2 bis 6 dieses Artikels dient.
Erläuterung
Die Maßnahmen umfassen den Vermögensübergang, den Übergang von Verbindlichkeiten, Rechtsgeschäftliche Verfügungen, die Auskunftserteilung und die Grundbuchberechtigung.
Sozialgesetzbuch
Rechtsgrundlage
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - (SGB X) (Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.1980, (BGBl. I S. 1469, 2218), in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2001 (BGBl. I S. 130) (BGBl III 860-10-1/2), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).
Zuständigkeiten
Öffentliche Stellen, soweit sie auch für das jeweilige Sozialleistungsverfahren nach dem SGB zuständig sind.
Gebührenregelung
Gemäß § 64 Abs. 2 SGB X - Kostenfreiheit -
Geschäfte und Verhandlungen, die aus Anlass der Beantragung, Erbringung oder der Erstattung einer Sozialleistung nötig werden, sind kostenfrei. Dies gilt auch für die im Gerichts- und Notarkostengesetz bestimmten Gerichtskosten. Von Beurkundungs- und Beglaubigungskosten sind befreit Urkunden, die
- in der Sozialversicherung bei den Versicherungsträgern und Versicherungsbehörden erforderlich werden, um die Rechtsverhältnisse zwischen den Versicherungsträgern einerseits und den Arbeitgebern, Versicherten oder ihren Hinterbliebenen andererseits abzuwickeln,
- im Sozialhilferecht, im Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende, im Recht der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, im Kinder- und Jugendhilferecht sowie im Recht der Kriegsopferfürsorge aus Anlass der Beantragung, Erbringung oder Erstattung einer nach dem Zwölften Buch, dem Zweiten und dem Achten Buch oder dem Bundesversorgungsgesetz vorgesehenen Leistung benötigt werden,
- im Schwerbehindertenrecht von der zuständigen Stelle im Zusammenhang mit der Verwendung der Ausgleichsabgabe für erforderlich gehalten werden,
- im Recht der sozialen Entschädigung bei Gesundheitsschäden für erforderlich gehalten werden,
- im Kindergeldrecht für erforderlich gehalten werden.
Landwirtschaftsanpassungsgesetz
Rechtsgrundlagen
- Gesetz über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik - Landwirtschaftsanpassungsgesetz - (LwAnpG) vom 29. Juni1990 (GBl. I S. 642) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418 - BGBl III VI-1), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586).
- Gesetz über die ländliche Entwicklung und zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes im Land Brandenburg (Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz - BbgLEG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 14, S. 298) geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl. I/10, Nr. 28)
Zuständigkeiten
- Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Gebührenregelung
§ 62 LwAnpG - Kosten
Die Kosten des Verfahrens zur Feststellung und Neuordnung der Eigentumsverhältnisse trägt das Land (Staat).
§ 67 LwAnpG - Freiheit von Steuern und Abgaben
(1) Die zur Durchführung dieses Gesetzes vorgenommenen Handlungen, einschließlich der Auseinandersetzung nach § 49 LwAnpG, sind frei von Gebühren, Steuern, Kosten und Abgaben.
(2) Die Gebühren-, Kosten-, Steuer- und Abgabenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die zuständige Landwirtschaftsbehörde, in Verfahren nach den §§ 54 LwAnpG (Freiwilliger Landtausch), 56 LwAnpG (Bodenordnungsverfahren) und 64 LwAnpG (Zusammenführung von Boden und Gebäudeeigentum) die zuständige Flurneuordnungsbehörde bestätigt, dass eine Handlung der Durchführung dieses Gesetzes dient.
§ 13 BbgLEG - Kosten- und abgabefreie Geschäfte und Verhandlungen
(1) Geschäfte und Verhandlungen, die dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Steuern, Gebühren, Kosten und Abgaben, die auf landesrechtlichen Vorschriften beruhen.
(2) Die Steuer-, Gebühren-, Kosten- und Abgabenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die obere Flurbereinigungsbehörde versichert, dass ein Geschäft oder eine Verhandlung dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes oder des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes dient.
Sachenrechtsbereinigungsgesetz
Rechtsgrundlage
Gesetz zur Sachenrechtsbereinigung im Beitrittsgebiet (Sachenrechtsbereinigungsgesetz - SachenRBerG) vom 21.09.1994 (BGBl. I. S. 2457 - BGBl. III 403-23-2), zuletzt geändert durch Artikel 21, des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586)
Zuständigkeiten
Der Abschluss von Verträgen zur Bestellung von Erbbaurechten, zum Kauf eines Grundstücks oder Gebäudes oder zur Ablösung der aus der baulichen Investition begründeten Rechte unterliegt dem notariellen Vermittlungsverfahren. Sachliche und örtliche Zuständigkeit sind in § 88 SachenRBerG geregelt.
Gebührenregelung
§ 91 SachenRBerG - Akteneinsicht und Anforderung von Abschriften durch den Notar
Der Notar ist berechtigt, die Akten der betroffenen Grundstücke und Gebäude bei allen Gerichten und Behörden einzusehen und Abschriften hieraus anzufordern. Er hat beim Amt zur Regelung offener Vermögensfragen und beim Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, oder, falls das Grundstück zu einem Unternehmen gehört, auch beim Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen, in deren Bezirk das Grundstück belegen ist, nachzufragen, ob ein Anspruch auf Rückübertragung des Grundstücks oder des Gebäudes angemeldet oder ein Antrag auf Aufhebung des Nutzungsrechts gestellt worden ist. Für Auskünfte und Abschriften werden keine Gebühren erhoben.
Vermögensgesetz
Rechtsgrundlage
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz - VermG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.02.2005 (BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23.05.2011 (BGBl. I S. 920)
Gebührenregelung
§ 38 Abs. 1 VermG - Kosten
Das Verwaltungsverfahren einschließlich des Widerspruchsverfahrens ist kostenfrei (siehe verwaltungsrechtliche Hinweise - Restitution).
Hinweis:
Die Kostenfreiheit des Verwaltungsverfahrens (Restitutionsverfahren) für den Antragsteller schlägt nicht auf die Vermessungs- und Katasterbehörden durch.
Amtshilfe nach § 27 Abs. 1 VermG liegt nicht vor.
LANDESRECHT
18.12.2007 Kommunalverfassung
29.06.2004 BbgLEG
08.11.1996 ev. Kirchenvertrag
24.05.2004 Denkmalschutzgesetz
Bundesrechtliche Regelungen
Kommunalverfassung
Rechtsgrundlagen
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I/13, Nr. 18)
Zuständigkeit
Die Gemeinden des Landes Brandenburg
Gebührenregelung
§ 7 Abs. 7 BbgKVerf
(7) Rechtshandlungen, die aus Anlass der Änderung eines Gebietes einer Gemeinde erforderlich sind, sind frei von öffentlichen Abgaben, soweit diese auf Landesrecht beruhen
Erläuterung
Eine Rechtshandlung ist jedes erlaubte rechtswirksame Handeln, an das sich Rechtsfolgen knüpfen.
„Öffentliche Abgaben“ ist ein Grundbegriff für alle Geldleistungen, die der Bürger (Kostenschuldner) Kraft öffentlichen Rechts an den Staat oder sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts abzuführen hat.
Die in § 10 Abs. 8 GO geregelte Gebührenbefreiung bezieht sich nur auf landesrechtliche Gebühren.
Ausführung des Flurbereinigungs- und Landwirtschaftsanpassungsgesetzes
Rechtsgrundlage
Gesetz über die ländliche Entwicklung und zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes im Land Brandenburg (Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz- BbgLEG) vom 29. Juni 2004 (GVBl. I/04, Nr. 14, S. 298) geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl. I/10, Nr. 28)
Zuständigkeit
- Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Gebührenregelung
§ 13 BbgLEG - Kosten- und abgabefreie Geschäfte und Verhandlungen
(1) Geschäfte und Verhandlungen, die dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes und des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes dienen, einschließlich der Berichtigung der öffentlichen Bücher, sind frei von Steuern, Gebühren, Kosten und Abgaben, die auf landesrechtlichen Vorschriften beruhen.
(2) Die Steuer-, Gebühren-, Kosten- und Abgabenfreiheit ist von der zuständigen Behörde ohne Nachprüfung anzuerkennen, wenn die obere Flurbereinigungsbehörde versichert, dass ein Geschäft oder eine Verhandlung dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes oder des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes dient.
Erläuterung
Die Gebührenbefreiung nach § 108 FlurbG gilt auf Grund der landesrechtlichen Vorschrift des § 13 BbgLEG für alle Amtshandlungen der Kataster- und Vermessungsämter.
ev. Kirchenvertrag
Rechtsgrundlagen
Gesetz zu dem Vertrag vom 8. November 1996 zwischen dem Land Brandenburg und den evangelischen Landeskirchen in Brandenburg, vom 10. März 1997 (GVBl. I S. 4, 13), in Verbindung mit dem
Vertrag zwischen dem Land Brandenburg und des evangelischen Landeskirchen in Brandenburg (Evangelischer Kirchenvertrag Brandenburg) vom 8. November 1996 (GVBl. I/97 S. 4)
Zuständigkeit
- die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg
- die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen,
- die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz,
- die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs,
- die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens,
- die Pommersche Evangelische Kirche,
- die Evangelische Kirche der Union,
Gebührenregelung
Artikel 17, Gebührenbefreiung
(1) Die Kirchen sind von der Zahlung der auf Landesrecht beruhenden Verwaltungsgebühren befreit, soweit die Amtshandlung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im Sinne des § 54 der Abgabenordnung dient.
(2) Die Befreiung gilt auch für Gebühren, die die ordentlichen Gerichte in Angelegenheiten der streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Gerichtsvollzieher, die Justizverwaltungsbehörden und die Behörden der Arbeitsgerichtsverwaltung erheben. Von den Kirchen gebildete juristische Personen des Privatrechts, die unmittelbar kirchliche Zwecke verfolgen, sind von der Zahlung der Gebühren nach der Kostenordnung und der Gebühren in Justizverwaltungsangelegenheiten befreit.
Erläuterung
Die Gebührenbefreiung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 gilt für die vertragschließenden Kirchen, ihre Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände sowie ihre sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit.
§ 54 AO 1977 - Kirchliche Zwecke
(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern.
(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errichtung, Ausschmückung und Unterhaltung von Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Gottesdiensten, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchenvermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und Waisen.
Denkmalschutzgesetz
Rechtsgrundlage
Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24.05.2004 (GVBl. I S. 215)
Zuständigkeit
Zuständig sind die Denkmalschutz- und Denkmalfachbehörden. Oberste Denkmalschutzbehörde ist das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg. Untere Denkmalschutzbehörden sind die Landkreise und kreisfreien Städte. Denkmalfachbehörden sind das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Brandenburgische Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte Potsdam mit den Aufgaben und Befugnissen der Denkmalfachbehörde für Bodendenkmale.
Gebührenregelung
§ 22 BbgDSchG - Gebühren und Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
(1) Für die Denkmalschutzbehörden und die Denkmalfachbehörde sind Auszüge aus Büchern, Schriftstücken und Flurkarten des Liegenschaftskatasters, auch in elektronisch gespeicherter Form, frei von Gebühren und Auslagen.
(2) Bescheinigungen für die Erlangung von Steuervergünstigungen werden von der Denkmalschutzbehörde ausgestellt.
Verwaltungsrechtliche Hinweise
Amtshilfe (Verwaltungsverfahrensgesetz)
Beitreibung (Verwaltungsvollstreckungsgesetz)
Amtshilfe
Rechtsgrundlage:
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 9.07.2009 (GVBl. I S. 262, 264), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I. Nr. 18) (§ 1 VwVfGBbg) in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 1388)
Regelung
§ 4 (VwVfG)
Amtshilfepflicht
(1) Jede Behörde leistet anderen Behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe).
(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn
- Behörden einander innerhalb eines bestehenden Weisungsverhältnisses Hilfe leisten;
- die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der ersuchten Behörde als eigene Aufgabe obliegen.
§ 5 (VwVfG)
Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe
(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn sie
- aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann;
- aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur Vornahme der Amtshandlung erforderlichen Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann;
- zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbekannt sind und die sie selbst nicht ermitteln kann;
- zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz der ersuchten Behörde befinden;
- die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand vornehmen könnte als die ersuchte Behörde.
(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn
- sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist;
- durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile bereitet würden.
Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen.
(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten, wenn
- eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher oder mit wesentlich geringerem Aufwand leisten kann;
- sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte;
- sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfeleistung die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde.
(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb verweigern, weil sie das Ersuchen aus anderen als den in Absatz 3 genannten Gründen oder weil sie die mit der Amtshilfe zu verwirklichende Maßnahme für unzweckmäßig hält.
(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für verpflichtet, so teilt sie der ersuchenden Behörde ihre Auffassung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, so entscheidet über die Verpflichtung zur Amtshilfe die gemeinsame fachlich zuständige Aufsichtsbehörde oder, sofern eine solche nicht besteht, die für die ersuchte Behörde fachlich zuständige Aufsichtsbehörde.
Hinweise
§ 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) nimmt bestimmte Rechtsgebiete und Verfahren ganz oder teilweise von seinem Anwendungsbereich aus. Hierzu gehört das Lastenausgleichsrecht. Es handelt sich hierbei um ein Gesetz mit stark ausgeformtem - jedoch nicht abschließendem - eigenen Verwaltungsrecht (Kommentar Stelkens/Bonk/Sachs Rn. 93, 94 zu § 2 VwVfG, 6. Auflage, 2001; Das Deutsche Bundesrecht, Stand 2001). Das VwVfG greift insoweit auch nicht subsidiär ein. Seine Grundgedanken können aber zur Lückenfüllung und zur Auslegung des Verfahrensrechts der ausgenommenen Rechtsgebiete herangezogen werden.
Die §§ 4 bis 8 VwVfG formen die in Artikel 35 Abs.1 GG statuierte Verpflichtung und Berechtigung der Behörden aus, sich gegenseitig Amtshilfe zu leisten, ohne das Amtshilferecht abschließend zu regeln. Im § 317 LAG wird lediglich die Amtshilfeleistung festgeschrieben (einfachrechtlich wiederholt), jedoch nicht näher definiert. Auch die Erläuterung zum Gesetz geht nicht über die Erläuterungen zu Artikel 35 Abs. 1 GG hinaus. Das LAG definiert den Amtshilfebegriff daher nicht neu oder anders; deshalb sind die Bestimmungen im Verwaltungsverfahrensgesetz heranzuziehen, allerdings nur soweit diese nicht nach Erlass des LAG neu entwickelt wurden.
Danach liegt Amtshilfe dann nicht vor, wenn die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der ersuchten Behörde als eigene Aufgabe obliegen. Hierfür ist wesentlich, ob der ersuchten Behörde die Aufgabe durch oder auf Grund eines Gesetzes zur eigenständigen Erledigung im eigenen Namen übertragen wurde und ob deshalb für die ersuchende Behörde auch außerhalb von Amtshilfe ein Anspruch auf die Hilfeleistung besteht (Kommentar Stelkens/Bonk/Sachs Rn. 35 ff zu § 4 VwVfG, 6. Auflage, 2001; ebenso BGH, Urteil vom 21.06.2001, NJW 2001, 2799, und OVG Brandenburg, Beschluss vom 23.07.1997, RiA 1998, 298, 299. auch OVG Münster, Beschluss vom 19.11.1991, NVwZ-RR 1992, 527).
Nach § 195 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 11 Brandenburgische Gutachterausschussverordnung des Landes Brandenburg (BbgGAV) sind die Gutachterausschüsse zu Auskünften über Bodenrichtwerte nach § 196 Abs. 3 BauGB - als ihnen zugewiesene, eigene Aufgabe - verpflichtet, unabhängig davon, wer die entsprechende Auskunft verlangt. Zu diesen eigenen Aufgaben gehören u.a. auch die Erstattung von Verkehrswertgutachten und die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung. Basierend auf meinen Ausführungen zur Amtshilfe kann daher der Auffassung des Bundesausgleichsamts nicht gefolgt werden, dass es sich bei der Erteilung von Auskünften an die Ausgleichsbehörden eindeutig um Amtshilfe handelt. Eine Kostenfreistellung nach § 317 LAG ist nicht gegeben. Auch im Hinblick auf die Behandlung anderer Amtshilfeersuchen muss ich zu dem Ergebnis kommen, dass die Erteilung der Auskünfte auch für die Ausgleichsbehörden gebührenpflichtig ist.
Beitreibung
Rechtsgrundlagen
1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg) vom 16. März 2013 (GVBl. I Nr. 18)
2 Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg (Bbg KostO) vom 2. September 2013 (GVBl. II Nr. 64)
Hinweise
Die Gesetzesbezeichnungen sind direkt mit der gesetzlichen Regelung der Gesetzessammlung des Landes Brandenburg “BRAVORS/Landesrecht“ verknüpft.
Restitution (Vermögensgesetz)
Rechtsgrundlage
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz - VermG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.02.2005 (BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23.05.2011 (BGBl. I. S. 920)
Regelung
Nach § 38 Abs. 1 VermG (Kosten) ist das Verwaltungsverfahren einschließlich des Widerspruchsverfahrens kostenfrei.
Hinweis
Die Kostenregelung des § 38 VermG bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem Antragsteller der Restitution und der Behörde, die den Antrag bearbeitet und den Bescheid erlässt. Diese Kostenregelung ist für Anträge der Restitutionsbehörden an andere Behörden nicht anwendbar (siehe Rechtsprechung).
Rechtsprechung:
Aufgrund sondergesetzlicher Vorschriften bleibt der Antrag nicht gebührenfrei. Die sachliche Gebührenfreiheit der bundesrechtlichen Bestimmung des § 38 Abs. 1 Vermögensgesetz i. V. m. § 6 Abs. 2 Ausgleichsleistungsgesetz kann nicht in Anspruch genommen werden. § 38 Abs. 1 Vermögensgesetz bezieht sich nur auf Verwaltungsverfahren, die im Vermögensgesetz geregelt sind und in denen die dafür zuständigen Vermögensämter entscheiden. Entsprechendes gilt für Verfahren nach dem Ausgleichsleistungsgesetz. Nur das Vermögensamt ist im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeit gehindert, Verwaltungsgebühren zu erheben. (Urteil, VG Potsdam, 10 K 5928/97).
Die sachliche Gebührenfreiheit nach VermG (§ 38 Abs. 1) bezieht sich nur auf Verwaltungsverfahren, die im Vermögensgesetz geregelt sind und in denen die dafür zuständigen Vermögensämter entscheiden. Entsprechendes gilt für Verfahren nach dem Ausgleichsleistungsgesetz (Urteil, VG Potsdam, 10 K 45/98).
Es handelt sich jedenfalls nicht um ein im Vermögensgesetz vorgesehenes und seiner Durchführung dienendes Annexverfahren. Es steht anderen Antragstellern frei, gegen diese von ihr für rechtswidrig erachtete Praxis der Vermögensämter, die Erteilung eines “Negativattestes“ von der Führung einer lückenlosen Eigentümerrückverfolgung durch die Antragstellerin anhängig zu machen - ggf. im Klagewege - vorzugehen. Die Anwendung des § 38 Abs. 1 VermG scheitert auch daran, dass für den Antragsgegner aufgrund von Anträgen anderer Antragsteller auf Durchführung von “Voreigentumsrecherchen“ gar nicht erkennbar ist, dass sie Amtshandlung im Vorgriff auf ein beabsichtigtes Vergewisserungsverfahren nach § 3 Abs. 5 VermG beantragt wird (Urteil VG Potsdam, 4 L 1267/98).
Der Antrag auf Zulassung der Beschwerde gegen das Urteil des VG Potsdam (4 L 1267/98) wegen vorläufigen Rechtsschutzes wurde abgelehnt. Das Gericht führte zum Hauptverfahren zusätzlich aus, dass das Argument, nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dürfe der Komplex “Restitutionsverfahren im weiteren Sinne“ nicht gedanklich in einzelne Verfahren aufgeteilt werden, für sich genommen nichts dazu besagt, welche Verfahren im Einzelnen zu diesem Komplex zu zählen und deshalb kostenfrei sind.
Von der Kostenfreiheit nach § 38 VermG sind nicht, wie sich indirekt auch aus § 38 Abs. 2 Satz 1 VermG ergibt, die vom Antragsteller selbst - beispielsweise für eigene Recherchen in staatlichen Archiven - bei anderen Behörden verursachten Kosten erfasst. Hier kommt lediglich eine Kostenerstattung durch die Restitutionsbehörde für den Fall in Betracht, dass die Recherchen für die Durchführung des Restitutionsverfahrens erforderlich waren und sonst durch die Restitutionsbehörde hätte erfolgen müssen (Urteil, VG Potsdam, 4 K 3973/02).
Liegenschaftsvermessung
Verwaltungsgericht Leipzig - Urteil 6 K 501/97
Die nach erfolgter Restitution für die Berichtigung des Grundbuchs erforderlichen Neuvermessungen von Grundstücksflächen gehören zum Verwaltungsverfahren des VI Abschnitts des Vermögensgesetzes. Insoweit anfallende Vermessungskosten sind wegen der Kostenfreiheit des Rückübertragungsverfahrens nach § 38 Abs. 1 VermG nicht vom Restitutionsantragsteller zu tragen. Letztlich haben die Vermögensämter die Vermessungskosten selbst zu tragen, da die Vermessungsämter keine Amtshilfe im Sinne von § 4 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz leisten (Urteil, VG Leipzig, 6 K 501/97).
Verwaltungsgericht Magdeburg - Urteil 4 A 160/99 MD
Auch die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung als Annexverfahren zum Restitutionsverfahren zählt zu den kostenfreien vermögensrechtlichen Verwaltungsverfahren im Sinne von § 38 Abs. 1 VermG. Soweit Sinn und Zweck der Kostenfreiheit daraus resultieren, den “wahren“ Berechtigten nach dem VermG bei der notwendigen Rechtsfolge nicht mit zusätzlichen Kosten zu belasten, so betrifft die Kostenfreiheit eben nicht allein “nur“ das Verfahren des nach der Prüfung als (wahren) Berechtigten vom Amt zur Regelung offener Vermögensfragen festgestellten Berechtigten, sondern auch die anderen Verfahrensbeteiligten, wie konkurrierende Anmelder, Rechtsnachfolger und auch der Verfügungsberechtigte sowie die von ihm beauftragten Personen und Institutionen partizipieren von dieser Kostenfreiheit. Diese Kostenfreiheit muss dann auch für ein das Verfahren durchführende Amt zur Regelung offener Vermögensfragen gelten. Insoweit sind die Behörden lediglich vorauseilend zu Gunsten des Restitutionsberechtigten tätig (Urteil, VG Magdeburg, 4 A 160/99 MD).
Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt
Das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt hat die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg 4 A 160/99 MD nicht zugelassen und führt dazu Folgendes aus:
Nach dem VermG ist das Verwaltungsverfahren (der Restitutionsberechtigten) bei den Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen einschließlich des Widerspruchsverfahrens kostenfrei. Die Vermessung ist aber Voraussetzung, um beim Grundbuchamt die entsprechenden Eintragungsanträge stellen zu können. Die Vermögensämter sind daher in diesen Fällen verpflichtet, auf ihre Kosten eine Vermessung und die katasteramtliche Erfassung durchführen zu lassen. Nichts anderes kann gelten, wenn sich nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens herausstellt, dass die Teilfläche, die dem früheren Eigentümer bestands- bzw. rechtskräftig zugesprochen wurde, mit der vom Vermögensamt ursprünglich eingemessenen Flächen nicht identisch ist.
Das Verwaltungsgericht Leipzig hat der Klage gegen den Kostenbescheid für die Liegenschaftsvermessung (Herstellung der alten Grundstücke) stattgegeben. Das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen (ARoV) hat den Restitutionsberechtigten aufgefordert, selbst beim Vermessungsamt die Liegenschaftsvermessung zu beantragen. Nach erfolgreichem Widerspruch gegen den Kostenbescheid wurde dem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen der Bescheid zugestellt.
Die Klägerinnen haben im Rahmen eines Restitutionsverfahrens die hier gegenständlichen Grundstücksflächen zurückübertragen erhalten. Zum Verfahren gehört nach § 34 Abs. 2 S. 1 VermG, dass die Behörde bei der Rückübertragung von Eigentums- oder sonstigen dinglichen Rechten an Grundstücken und Gebäuden das Grundbuchamt um die erforderlichen Berichtigungen des Grundbuches ersucht.
Die Feststellung der Grundstücksverhältnisse gehört zur Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhaltes und ist sachliche Voraussetzung für den Erlass eines Restitutionsbescheides der Behörde. Das ARoV ist in diesen Fällen verpflichtet, auf seine Kosten und für die Beteiligten kostenfrei eine Vermessung und die katasteramtliche Erfassung durchführen zu lassen.
Das ARoV hingegen kann derartiges schon aufgrund der Vorschrift des § 27 VermG (Amts- und Rechtshilfe) durchsetzen. Die anfallenden Vermessungskosten können nicht auf die Restitutionsantragsteller abgewälzt werden. Das fiskalische und arbeitsökonomische Risiko, die Vermessung wiederholen zu müssen, gehe zu Lasten der ARoV.
Verwaltungsgericht Leipzig - Urteil 6 K 1533/98
Ob die ÄRoV die Vermessungskosten selbst zu tragen hätten, da die Vermessungsämter keine Amtshilfe im Sinne von § 4 abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG - leisten würden, bleibt hier offen (Urteil, VG Leipzig, 6 K 1533/98).
Verwaltungsgericht Potsdam - Ausführung zu den Verfahren 4 K 2212/01 und 4 K 3118/01
Im Verwaltungsstreitverfahren hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichtes Potsdam am 9.12.2003 Folgendes ausgeführt:
Es wird darauf hingewiesen, dass der Klage (hier gegen den Kostenbescheid des KVA) voraussichtlich kaum Aussicht auf Erfolg zukommt.
Nach Ansicht der Kammer dürfte nämlich aus der in § 38 Abs. 1 VermG geregelte Kostenfreiheit des vermögensrechtlichen Verwaltungsverfahrens nicht zu folgern sein, dass von den Vermögensämtern beantragte Vermessungstätigkeiten im Ergebnis auch für diese kostenfrei sind. Die gegenteiligen Entscheidungen des VG Magdeburg bzw. des OVG Sachsen-Anhalt überzeugen die Kammer derzeit nicht. Zwar dürfte es zutreffen, dass solche Vermessungstätigkeiten Annexverfahren zum Restitutionsverfahren sind und deshalb für den Restitutionsberechtigten nach § 38 Abs. 1 VermG keine Kosten entstehen. Jedoch erscheint der den genannten Urteilen zugrunde liegende Schluss, dass sich die Kostenfreiheit auch auf die Vermögensämter erstrecke, weil diese lediglich vorauseilend zugunsten des Restitutionsberechtigten tätig seien, nicht zwingend. Denn aus der Regelung des § 38 Abs. 1 VermG kann wohl nicht entnommen werden, dass im Verwaltungsverfahren keinerlei Kosten entstehen (können), sondern nur, dass entstandene Kosten von den Antragstellern - unabhängig vom Erfolg des Restitutionsantrags - nicht zu tragen sind. Dieses Verständnis der Norm finde im Übrigen auch eine Stütze in der in der Klageerwiderung genannten Empfehlung des Bundesministeriums der Justiz vom 05.10.1992, wonach die Vermögensämter auf eine Vermessung bereits vor Erlass des Restitutionsbescheides verzichten sollen (vgl. Nachweis Seite 4 des Urteils des OVG Sachsen-Anhalt vom 25.02.2003). Begründet wurde dies mit dem von den Vermögensämtern zu tragenden Risiko, anderenfalls nach Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens ggf. eine kostenintensive und arbeitsaufwendige Vermessung wiederholen zu müssen, etwa wenn sich herausstellt, dass der Rückgabeanspruch für eine andere als die ursprünglich eingemessene Teilfläche besteht (OVG Sachsen-Anhalt, a.a.0.). Es ist nicht nachvollziehbar, welches kostenintensive Risiko der Vermögensämter damit gemeint sein soll, wenn die Vermessung nach § 38 Abs. 1 VermG auch für die Vermögensämter kostenfrei wäre.
Eine Gebührenbefreiung der Klägerin ergibt sich voraussichtlich auch nicht aus den jeweiligen Runderlassen des Ministeriums des Innern vom 22.07.1999 bzw. vom 19.02.2001. Insbesondere dürfte es sich bei der hier beantragten Teilungsvermessung nicht um eine "Leistung der Katasterämter" im Sinne der Erlasse handeln. Dies dürfte sich aus einer Gesamtschau der in den Erlassen getroffenen Regelungen sowie aus dem jeweiligen Bezug zur - durch die Vermögensämter vorrangig zu bewirkenden - Selbstentnahme von Angaben aus dem Liegenschaftskataster zu folgern sein (vgl. Nr. 2 des Erlasses in Vermessungs- und Katasterangelegenheiten vom 19.02.2001). Leistungen im Sinne des Erlasses sind deshalb wohl nur Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Entnahme von Daten aus dem Liegenschaftskataster stehen. Vergleichsweise wesentlich kostenintensivere Vermessungstätigkeiten - wozu die Teilungsvermessung gehört - dürften von dem Erlass somit nicht erfasst sein.
Schließlich ist auch eine generelle Gebührenbefreiung der Klägerin als Landesbehörde aus dem Gebührengesetz bzw. der anzuwendenden Vermessungsgebührenordnung nicht ersichtlich, vgl. § 3 Abs. 2 GebGBbg i. V. m. § 4 VermGebO vom 16.09.2011.
 Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschriften 